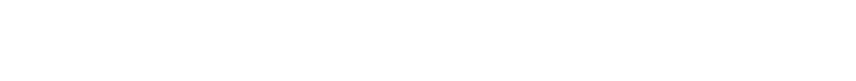Der Kapitalismus hat seine Rechnungen nicht bezahlt. Alles, was er zur Vermehrung seines Reichtums brauchte, kaufte er immer billiger ein - von der Natur bis zur menschlichen Arbeit. Die heutige Flut von Krisen ist das Ergebnis davon und markiert das Ende des Kapitalismus in seiner jetzigen Form.
This text has been auto-translated from Polish.
Jakub Majmurek: Wenn wir den Durchschnittsbürger fragen, welcher Gegenstand den modernen Kapitalismus am besten symbolisiert, wäre die Antwort wahrscheinlich ein Smartphone oder ein Mikroprozessor. In Ihrem Buch Geschichte der Welt in sieben billigen Dingen geben Sie eine ganz andere Antwort: Das beste Symbol für die aktuelle Form des Kapitalismus sind Chicken Nuggets. Und warum?
Raj Patel: Weil es uns erlaubt, die beiden Probleme, über die wir in dem Buch schreiben, besser als alles andere zu illustrieren: erstens das Kapitalozän und zweitens die Billigkeit.
Kapitalozän, das heißt?.
R.P.: Die geologische Epoche, in der wir leben und die in den Fossilienaufzeichnungen sichtbar ist. Wir nennen es nicht Anthropozän, weil das Problem hier nicht der Mensch und seine Aktivitäten sind, sondern ein bestimmtes sozioökonomisches System - der Kapitalismus - und sein Verhältnis zur Natur.
Hähnchen-Nuggets veranschaulichen dies perfekt. Das Huhn, das für dieses Gericht verwendet wird, ist heute das am weitesten verbreitete Tier der Welt. Ursprünglich stammt es aus Ostasien, wurde aber domestiziert und als Teil eines bestimmten Konzepts für das Netz des Lebens popularisiert, das davon ausgeht, dass der Mensch die Natur als Ressource behandeln kann, die er ausbeuten und manipulieren kann. Dies zeigt die Rolle, die die teure Natur im Kapitalismus spielt.
Um ein lebendes Huhn in Nuggets zu verwandeln, braucht man Arbeitskräfte, die wiederum so billig wie möglich sind. Dies ist also die zweite billige Sache, die in der Geschichte des Kapitalismus eine zentrale Rolle spielt: billige Arbeit. Die Nuggets selbst werden hauptsächlich von der Arbeiterklasse konsumiert - auch das ist typisch für die Geschichte des Kapitalismus, der für seine Entwicklung immer billige Lebensmittel für die Arbeiterklasse brauchte, weil er so niedrige Löhne zahlen und die Arbeitskosten niedrig halten konnte. Wir haben also eine weitere billige Sache - billige Lebensmittel.
Zur Herstellung von Nuggets braucht man Energie - ebenfalls so billig wie möglich. Billige Energie ist eine weitere billige Sache, die der Kapitalismus braucht. Jede Fabrik wird von einer energiebetriebenen Mine oder Ölquelle begleitet.
Die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sind hart, und die Arbeiter klagen über Burnout, Verletzungen und körperliche Erschöpfung. Um am Produktionsprozess teilnehmen zu können, brauchen sie Pflegearbeit, die der Kapitalismus auch immer versucht hat, so billig wie möglich zu machen. Also haben wir eine weitere billige Sache, die Pflege. In den USA wurden Fast-Food-Ketten wie KFC schon immer mit zinsgünstigen Krediten unterstützt - und das ist eine weitere billige Sache, die für den Kapitalismus zentral ist: billiges Geld.
Das sind sechs der sieben billigen Dinge im Titel Ihres Buches - alles in einem Stück Huhn. .
R.P.: Es gibt auch ein siebtes: billiges Leben. Es geht um bestimmte Herrschaftsstrukturen, um individuelle und soziale Zukunftswege, die in den Prozess der Herstellung von Chicken Nuggets eingebettet sind.
Jason W. Moore: Dabei ist es wichtig zu betonen, dass die billige Natur immer ein Schlachtfeld ist. Sie ist nicht billig für Sie, für uns oder für unsere Leser, sondern für das Kapital und die Kapitalisten. Und sie ist billig im doppelten Sinne des Wortes: Sie kostet nicht nur wenig, sondern sie ist auch ohne Wert, ohne Respekt, ohne Würde. Die kapitalistische Ausbeutung der Natur, des Lebens, der Arbeit, all der Dinge, von denen Raj sprach, ist immer eine gewisse Strategie der Abwertung.
Sie stellen die These auf, dass die Geschichte des Kapitalismus als die Geschichte des Prozesses der Abwertung dargestellt werden kann. Aber wie definieren Sie "Verbilligung"? Kann man in Ihren Worten sagen, dass es sich um die unterbezahlte Arbeit der Menschheit und die nicht-menschliche, unterbezahlte Arbeit der Natur handelt?.
J.W.M: Teilweise ja, aber es lohnt sich, daran zu erinnern, dass die Geldverhältnisse im Kapitalismus immer auf einer Grundlage unbezahlter Arbeit entstehen - hauptsächlich Frauen und alles, was der Kapitalismus als Natur darstellt. Das ist nicht nur für das Verständnis der aktuellen Krise entscheidend, sondern auch für die zugrunde liegende Unterdrückungsdynamik, die Prozesse der Schaffung von Klima-Klassen-Spaltungen, Klima-Patriarchat und Klima-Apartheid.
R.P.: Das Wort "Dynamik" ist hier der Schlüssel. In Sieben billige Dinge zeigen wir die Dynamik des Kapitalismus als ein System, das sich weigert, seine Rechnungen zu bezahlen. Und wenn die Krise zuschlägt - wenn Arbeiter höhere Löhne fordern, wenn Frauen anfangen, für ihre Pflegearbeit bezahlt zu werden und so weiter -, dann sucht es nach anderen Quellen der Billigkeit.
Billige Dinge sind nie nur für sich allein billig. Sie werden billig als Teil einer spezifischen Dynamik, die durch Krisen gekennzeichnet ist, die durch den Kampf gegen den Prozess der Verbilligung und die Versuche des Kapitals, diese Krisen zu lösen, entstehen. Denn im Laufe der Geschichte entwickelt sich der Kapitalismus, indem er sich auf weitere Bereiche des Lebensnetzes ausdehnt und neue Bereiche und Arten der Produktion von Billigkeit hervorbringt.
Unser Buch endet mit der eher düsteren Feststellung, dass alle Bereiche der Billigkeit, alle sieben billigen Dinge, die für die Entwicklung des Kapitalismus notwendig sind, sich heute gleichzeitig in einer Krise befinden.
J.W.M.: Wir haben es derzeit mit einer echten Multikrise zu tun. Dabei handelt es sich nicht, wie Adam Tooze und die Financial Times uns glauben machen wollen, um eine Ansammlung vieler Einzelkrisen, sondern um eine einzige, fundamentale Krise, die sich in allen Bereichen der Billigkeit ausdrückt.
Ihr Buch ist eindeutig von der Theorie Immanuel Wallersteins inspiriert, denn wie er suchen Sie die Ursprünge des Kapitalismus bereits im langen 16. Wie definieren Sie den Kapitalismus im Allgemeinen? Was zeichnet ihn als ein System aus, das sich von den anderen unterscheidet?.
J.S.W.: Wir sind von Wallersteien inspiriert, der wiederum von dem großen polnischen Historiker Marian Małowist inspiriert wurde. Ich denke, es ist wichtig für die polnischen Leser, sich bewusst zu machen, dass nicht nur die Entstehung der atlantischen Welt mit ihren Kolonien, sondern auch die Volkswirtschaft in Osteuropa für die Entstehung des Kapitalismus notwendig war.
Wir definieren den Kapitalismus als eine Zivilisation, in der die endlose Akkumulation von Kapital im Vordergrund steht. Es geht nicht um wirtschaftliches Wachstum, sondern um unendliche Expansion, die sich das Leben, die Arbeit und die Landschaften der Menschen aneignet und dann verschlingt - alles, um die Profitrate zu steigern und Möglichkeiten für neue profitable Investitionen zu schaffen. Dieser Prozess ist mit der endlosen Eroberung von Land, Herrschaftspraktiken und Proletarisierung verbunden und stößt unserer Ansicht nach gerade an seine Grenzen.
Der Begriff der Grenze spielt in Ihrer Argumentation eine sehr wichtige Rolle, Sie beginnen sie mit einer Analyse der Rolle, die die atlantischen Grenzen bei der Entwicklung des Kapitalismus gespielt haben. Ist die Grenze ein Ort, an dem der Prozess der Produktion billiger Dinge besonders effektiv ablaufen kann?.
R.P.: Wir beginnen mit der portugiesischen Kolonisierung Madeiras im 15. Jahrhundert, weil sie ein perfektes Beispiel ist. Die portugiesische Kolonialexpansion beginnt nicht zufällig zu einem bestimmten Zeitpunkt: dem Zusammenbruch des mittelalterlichen Klimaoptimums und der Pestepidemie, dem "Schwarzen Tod", im 14. Jahrhundert.
Madeira ist eine der ersten Kolonien, in denen Zuckerrohr mit Hilfe von Sklavenarbeit angebaut wurde. Als der Zuckeranbau die Insel ökologisch erschöpfte, wurde sie zu einer Station auf der Sklavenhandelsroute zwischen Afrika und Amerika. Heute sind die Spuren dieses dunklen Erbes zu einer Touristenattraktion geworden.
Am Beispiel Madeiras sehen wir also nicht nur, wie in Grenzregionen Billigkeit erzeugt wird, sondern auch, wie der Kapitalismus angesichts von Krisen Grenzregionen neu definieren kann.
Der Kapitalismus kann nicht ohne Grenzgebiete existieren, aber auch das Kapital verändert bei seiner Expansion keineswegs nur Grenzgebiete. Grenzen verändern immer das Gebiet, das sich in sie hinein ausdehnt.
Warum ist die Grenze so wichtig für die Schaffung von Billigkeit?.
J.S.W.: Entscheidend sind die Prozesse der nicht-ökonomischen Aneignung von Arbeit - menschlicher und nicht-menschlicher, der Arbeit der Natur -, die in Grenzgebieten stattfinden. In jeder Epoche der kapitalistischen Entwicklung haben neue imperiale Grenzen eine Schlüsselrolle für die Akkumulation gespielt: in der Frühzeit des Kapitalismus waren es Zuckerrohrplantagen und Silberminen in Amerika, im 18. und frühen 19. Jahrhundert Baumwollplantagen, die entstanden, als sich die Grenzen der europäischen Kolonisation nach Westen verschoben, im späten 19. und frühen 20.
Weil der Kapitalismus möglichst wenig zahlen will und ein geradezu monströs ineffizientes System ist, muss er ständig an seine Grenzen stoßen und sich neu erfinden, um sich billige Arbeitskräfte und billige Natur anzueignen, denn das ist für sein Funktionieren absolut notwendig. Wir nähern uns nun dem Ende dieses Prozesses, denn seit mehr als einem halben Jahrhundert hat sich kein erfolgreicher Versuch ergeben, den Kapitalismus neu zu erfinden.
R.P.: Es gab den Neoliberalismus, aber er hat eigentlich nur eine weitere Periode der Stagnation gebracht.
Musk und Trumps Versprechen, den Mars zu besiedeln, ist kein Versuch, eine neue Grenze im Weltraum zu errichten?.
R.P.: Musk macht hier nichts Neues. Das Kapital interessiert sich schon seit einiger Zeit für den Weltraum, zum Beispiel für die Möglichkeit, Mineralien aus Asteroiden zu gewinnen. In der Financial Times gab es kürzlich einen interessanten Artikel über den Wettbewerb um die gemeinsamen Funkfrequenzen rund um den Mond - denn die vom Mond übertragenen Daten könnten die neue Grenze werden, die es ermöglicht, Kapital zu akkumulieren.
Information ist ein weiteres Schlüsselkonzept für die kapitalistische Grenze. Woran arbeitet Musk jetzt realistischerweise? Nicht an der Kolonisierung des Mars, sondern an der Übernahme der Kontrolle über das Zahlungssystem der US-Regierung. Denn die darin enthaltenen Informationen sind von unschätzbarem Wert - und ich denke, wir werden bald erleben, wie Musk sie zu Geld macht.
Das Beispiel der Biotech-Unternehmen, die unsere DNA zur nächsten Grenze machen, zeigt, dass Grenzen nicht räumlich sein müssen. Der Kapitalismus sucht ständig nach neuen Wegen, um Informationen, die bisher einfach Teil des Lebens waren, in eine Ware zu verwandeln; wie man etwas mit einem Preisschild versieht, das nie einen Preis hatte.
J.W.M.: Gleichzeitig zeigt die Tatsache, dass der Kapitalismus nach genau diesen Grenzen greift, dass wir am Ende der Billigkeit angelangt sind. Die Grenzen, die Musk zu errichten versucht, bieten keine Hoffnung auf den Anbruch eines neuen goldenen Zeitalters des Kapitalismus. Ihre Ausbeutung soll vor allem eine Umverteilung der Ressourcen zugunsten der 0,1 Prozent der Reichsten auslösen.
Der heutige Tag ist daher nicht so sehr der Beginn einer neuen Ära des Kapitalismus als vielmehr der Beginn einer Transformation hin zu einer neuen postkapitalistischen Ordnung. Meiner Meinung nach könnte sie der wissenschaftlichen Diktatur ähneln, die Aldous Huxley in Die schöne neue Welt beschrieben hat, sie wird durch eine extreme Zentralisierung der Unternehmensmacht und der Informationsflüsse gekennzeichnet sein.
Lassen Sie uns einen Moment in die Geschichte zurückkehren. In Ihrem Buch, das eine kurze Geschichte des Kapitalismus darstellt, spielt die industrielle Revolution eine sehr geringe Rolle. Christoph Kolumbus und seine Eroberungen in der Neuen Welt sind für Sie viel wichtiger als das, was im 18. Jahrhundert im Norden Englands geschah, als die Textilindustrie entstand, oder in Deutschland während der zweiten industriellen Revolution ein Jahrhundert später. Warum eine solche Wahl? .
R.P.: Weil alles, was an der Industriellen Revolution, wirklich interessant war, zur Zeit der Eroberung Madeiras bereits geschehen war. Die Standardisierung und Mechanisierung der Arbeit, die Umwandlung der Natur in einen Brennstoff, der zur Energiegewinnung verbrannt werden kann, die Prozesse, die Menschen auf eine Quelle billiger Arbeitskraft reduzieren, die Mechanismen, um sie mit billigen Kalorien und unbezahlter Pflegearbeit am Leben zu erhalten, und schließlich der Kredit zur Finanzierung von Kriegen, die die Grenzen des Kapitalismus immer weiter verschieben - all das zeichnete sich bereits mit der Entwicklung der Zuckerrohrplantagen auf Madeira um 1450 ab.
Wir sind nicht der Meinung, dass die industrielle Revolution nicht wichtig war. Aber damit sie überhaupt stattfinden konnte, mussten ihr mehrere ineinandergreifende Prozesse vorausgehen, die bis weit ins 16.
Jahrhundert zurückreichen. Dies ist heute, in einer Zeit des Interregnums, des Übergangs zwischen den Systemen, voller verschiedener pathologischer Symptome, besonders wichtig. Denn wir haben eine Systemkrise des Kapitalismus erreicht, während die Arbeiterklasse noch immer nicht die Instrumente entwickelt hat, um sich selbst zu regieren. Wir sind noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem die Arbeiterklasse genug Macht hat, um eine Transformation zum Sozialismus zu erzwingen. Die "bürgerliche Linke", wie wir sie nennen würden, ist völlig machtlos. In diesen dunklen Zeiten lohnt es sich daher, auf die Geschichte des Widerstands zurückzugreifen, auf die Geschichte der Kämpfe gegen die Expansion des Kapitalismus, die ein halbes Jahrhundert zurückreicht.
J.W.M.: Ein Großteil der gegenwärtigen Klimabewegung ist leider durch einen völligen Mangel an historischem Bewusstsein gekennzeichnet. Das zeigt sich am besten an Slogans wie "Stoppt einfach das Öl!". Denn das Problem ist nicht das Öl, sondern der Kapitalismus.
Wir können wirklich alles über die Klimapolitik einer Person herausfinden, wenn wir sie fragen, wann ihrer Meinung nach der Kapitalismus begann und damit auch, wo die aktuelle Klimakrise begann. Und sie begann im langen 16. Jahrhundert, als die europäische herrschende Klasse eine neue Zivilisation, eine neue kapitalistische Weltökologie schuf. Und heute droht uns die Achse Pentagon-Wall Street-Davos angesichts der Klimakrise ein neues, noch schlimmeres postkapitalistisches System zu schaffen.
Warum gehen die Möglichkeiten des Kapitalismus zu Ende? Die Möglichkeit, billige Dinge zu schaffen, ist zusammengebrochen?.
R.P.: Wir haben mit dem Huhn angefangen, und das könnte ein guter Zeitpunkt sein, um zu ihm zurückzukehren. Wir befinden uns mitten in einer Vogelgrippe-Epidemie, die vorerst die nicht-menschlichen Elemente des Lebensnetzes trifft, aber nur vorläufig. Wenn wir von Zehntausenden von Meeressäugern lesen, die an den Stränden der Arktis sterben, oder von Vögeln, die wie in der Apokalypse vom Himmel fallen, wird man das Gefühl nicht los, dass wir uns an einem ähnlich entscheidenden Moment befinden wie zu der Zeit, als das mittelalterliche Klimaoptimum zu Ende ging und Europa sich von den Schäden zu erholen begann, die ihm die Epidemie des Schwarzen Todes zugefügt hatte.
Wie verhält sich die weltweit herrschende Klasse in dieser Situation? Sie spricht zwar davon, den Mars zu kolonisieren, bunkert sich aber oft einfach ein, um die Apokalypse zu überleben.
J.W.M.: Die Reichsten bauen sich buchstäblich Bunker für den Fall einer Klimakatastrophe. Ich möchte eines betonen: Wir wiederholen nicht die Argumente der "Grenzen des Wachstums". Sie wurden von der transatlantischen herrschenden Klasse im Club of Rome in den 1970er Jahren als Antwort auf die Forderungen der Volksschichten, hauptsächlich in den Ländern des globalen Südens, entwickelt.
Wir halten es mit Marx: Die Grenze des Kapitalismus ist das Kapital selbst, verstanden in einem weiten Sinne als eine bestimmte Ökologie, eine Konstellation von Leben, Macht und Profit.
Was wir heute erleben, ist die Erschöpfung des Agrarmodells, das mit der zweiten Agrarrevolution in den Niederlanden und Großbritannien entstand und sich mit den Zuckerrohrplantagen über die ganze Welt verbreitete. Dieses Modell beruhte auf einem einfachen Prinzip: Wir produzieren immer mehr Nahrungsmittel mit immer weniger Arbeit. Und welche Hoffnungen wir auch immer in die Präzisionslandwirtschaft gesetzt haben mögen, aufgrund des Klimawandels ist dieses Modell an sein Ende gekommen. Und von diesem Modell hing die Versorgung mit billigen Lebensmitteln und damit auch mit billigen Arbeitskräften ab.
Was auch immer nicht an die Stelle des derzeitigen Systems tritt, wird irgendwie einer stationären Wirtschaft ähneln müssen, in der die Bevölkerungszahl und der Wohlstand mehr oder weniger konstant sind und nicht mit der Zeit wachsen.
Was könnte sich konkret entwickeln?
J.W.M.: Es gibt heute zwei große Projekte. Das eine hat ein Zentrum in Washington und der transatlantischen Welt, das andere in Peking. Natürlich gibt es in den USA und in der gesamten westlichen Welt einen andauernden Streit darüber, wie eine reaktionsfähige postkapitalistische Transformation auf die Klimakrise genau aussehen sollte, aber das US-Projekt bleibt in jeder Version zutiefst ungleich und militarisiert. Das chinesische Projekt hingegen versucht, die jahrtausendealte Dynamik des chinesischen Tributsystems wiederzubeleben, das ebenfalls zutiefst ungleich und herrschaftsbasiert ist, sich aber von dem auf der imperialistischen Vorherrschaft des Westens basierenden System unterscheidet.
Wir haben also die Wahl zwischen einer Trump-Musk-Zukunft oder einer Präsident-Xi-Zukunft?.
R.P.: Das sind heute die beiden größten Projekte. Aber das Interregnum, eine Zeit des Übergangs, bietet den Arbeiterklassen die Gelegenheit, die Möglichkeiten zu entwickeln, die es ihnen eines Tages erlauben werden, die Kontrolle über die Produktionsmittel zu übernehmen und die Hebel zu betätigen, die andere Szenarien freisetzen werden.
Natürlich erscheint die Vision von Arbeitnehmern, die die stationäre Wirtschaft autonom verwalten, viel vernünftiger als die Absichten von Washington oder Peking. Zugleich ist es sehr interessant zu hören, was China über die ökologische Zivilisation sagt. Es handelt sich noch nicht um eine Perspektive der Wiedereingliederung des Menschen in das Netz des Lebens, sondern um eine gewisse Neugestaltung der Beziehungen, die ihn mit diesem Netz verbinden.
Sicherlich sollten wir mehr anstreben als diese beiden vorherrschenden Visionen. Und dies geschieht überall auf der Welt. Wir sehen zum Beispiel, dass in China die Streiks zunehmen. Auch im Westen beginnt die Arbeiterklasse, nach Alternativen zu suchen. Obwohl ich die Arbeiterklasse hier nicht überbewerten möchte, denn andererseits haben in den USA viele Gewerkschafter den Löwenanteil von Trumps Agenda gekauft.
Ein Großteil der Theorie darüber, wie eine andere Zukunft aussehen könnte, wird direkt an der Front, in der Praxis, entwickelt. Ich schreibe gerade an einem neuen Buch darüber und möchte nicht zu viel verraten, aber wir haben zum Beispiel die Landlosenbewegung in Brasilien, die sehr daran interessiert ist, wie man die gesamte Beziehung der Menschen zum Lebensnetz überdenken kann, wie städtische Macht Beziehungen zu ländlichen Räumen aufbauen sollte, wie Maßnahmen zur Lösung der Wasserkrise zum Beispiel in demokratischen Praktiken verwurzelt sein können.
J.W.M.: Wie wir in unserem Buch zeigen, sind Klimakrisen immer ein Alptraum für die herrschenden Klassen. Die Serie von Volksaufständen, die durch das Ende des mittelalterlichen Klimaoptimums ausgelöst wurde, hat die spätmittelalterlichen Eliten fast in die Knie gezwungen. Dasselbe erlebten wir im 17. Jahrhundert und sogar Ende des 18. Jahrhunderts, am Ende der Kleinen Eiszeit. Dies ist die Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges, der Französischen Revolution und der Revolution in Haiti, des Tupac-Amaru-Aufstandes in Peru, der größten Hungerrevolten in Europa.
Wir sollten also keine Angst vor Klimakrisen haben. Und schon gar nicht sollten wir uns einem Klimanotstand unterwerfen, einer Huxley'schen Wissenschaftsdiktatur, die im Namen des Schutzes vor der Klimakatastrophe errichtet wird. Wie Naomi Klein vor einem Jahrzehnt treffend feststellte: Das Grundproblem ist eine Krise der Demokratie. Und die Alternative ist eine basisdemokratische, authentische Widerstandsbewegung gegen die verschiedenen autoritären Kräfte.
Bisher waren die Erfahrungen mit der Dezentralisierung, die man aus afrikanischen oder lateinamerikanischen Ländern kennt, die gezwungen waren, Strukturanpassungsprogramme durchzuführen, ausgesprochen negativ. Man kann sich aber auch eine andere Dezentralisierung vorstellen, die mit einer viel egalitäreren und demokratischeren Politik einhergeht.
**
Raj Patel - Autor zahlreicher Bücher, Filmemacher und Forscher an der Lyndon B. Johnson School of Public Affairs an der Universität von Texas in Austin. Er war einer der Organisatoren der Proteste der Gruppe "Alter Globalist" in Seattle im Jahr 1999. Als sozialer Aktivist setzt er sich für die Ernährungssouveränität ein.
Jason W. Moore - Professor für Soziologie an der Binghampton Universit. Seine Forschungsschwerpunkte sind Umweltgeschichte, historische Geographie und die Geschichte des Kapitalismus.