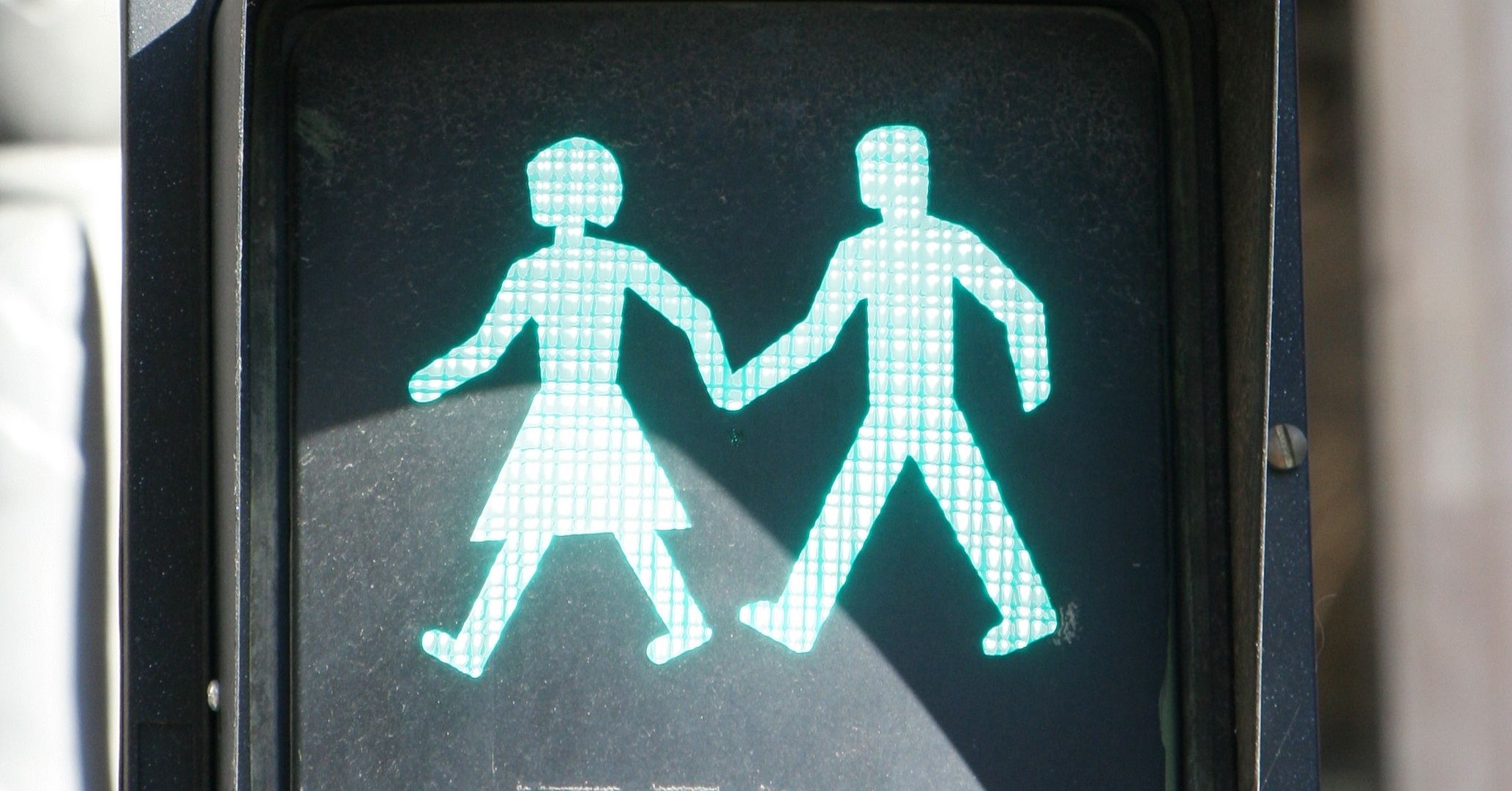In den Gemälden vergangener Malerinnen treten die Frauen aus ihrer Opferrolle heraus, überwinden die ihnen auferlegten Hierarchien und rächen sich am Patriarchat, zumindest in der Vorstellung. Ein "Kill Bill" aus dem siebzehnten Jahrhundert? Durchaus möglich.
This text has been auto-translated from Polish.
Die Bibliothek in unserer Nachbarschaft hat seit einigen Jahren eine feministische Abteilung. Literatur, die von Frauen geschrieben wurde, Essays, verständlich geschriebene Soziologie, Geschichte und Kulturwissenschaften. Auch Kinderbücher, zum Beispiel ein hervorragend illustriertes Buch über Geschlechterunterschiede, das zu einer Reihe gehört, in der auch Klassenunterschiede und Diskriminierungsmechanismen erklärt werden.
Daneben gibt es eine Sammlung von Biografien mehr oder weniger berühmter Frauen, die Geschichte gemacht haben. Sie beginnt mit Malerinnen aus prähistorischen Höhlen und hat einen schönen Titel: Don't Tell Us Fairy Tales. Es ist besser als Schlafende Schönheit, meine Tochter liebte es, diese Geschichten vor dem Einschlafen zu hören.
Leider schreibe ich nicht über Polen. Wenn es irgendwo in Polen solche Bibliotheken gibt, dann habe ich sie noch nicht entdeckt. Hier geht es um mein Viertel in Madrid, wo ich einen großen Teil meines Lebens verbracht habe.
Es ist nicht leicht, an der Gleichstellung zu arbeiten, und es bleibt noch viel zu tun, aber Spanien scheint mir ein gutes Beispiel dafür zu sein, welchen Weg man gehen kann. Die Unterschiede mögen gering sein, aber sie ergeben in der Summe ein anderes, freieres Umfeld. An Fußgängerüberwegen zeigen die Ampeln ein Mädchen oder ein Pärchen - getrenntgeschlechtlich oder gemischt - das zügig marschiert. Der Mann wird natürlich auch getroffen. Grünes Licht - also vorwärts.
Gabriele Münter
Das Wichtigste in Madrid ist, dass es sich bei der feministischen Abteilung in der Bibliothek nicht um eine Frauenecke handelt, die gnädigerweise zur Verfügung gestellt wurde, damit alles so bleiben kann, wie es war. Wir haben es nicht mit einer Nische für Freaks zu tun, sondern mit einer Veränderung, die das Ganze einbezieht.
Das spüre ich auch in meinem Bereich, der Kultur. In Spanien besuche ich Ausstellungen, deren Angebot wirklich beeindruckend ist. Am besten gefällt mir das Thyssen-Bornemisza-Museum, vor allem die Wechselausstellungen, die immer hervorragend vorbereitet sind. Dieses Mal bin ich bei Gabriele Münter gelandet. Ich bin keine Kunsthistorikerin, eher eine Amateurin, die gerne schaut und liest. Von Münter hatte ich schon gehört, aber sie war immer irgendwo am Rande. In Alben über den deutschen Expressionismus, eine Illustration. Häufiger Bilder der Gruppe Der Blaue Reiter oder von Wassily Kandinsky, die sie aufgenommen hat. Häufiger ein Gemälde von Kandinsky, das Münter an der Staffelei zeigt, als das, was sie selbst gemalt hat.
Münter war eine für ihre Zeit einzigartige Frau. Sie wurde in Berlin geboren, aber ihre Eltern lernten sich in den Vereinigten Staaten kennen und heirateten dort. Nach dem Tod ihres Vaters ging sie als 20-jähriges Mädchen mit ihrer Schwester für zwei Jahre nach Missouri, Arkansas und Texas. Später, zwischen 1904 und 1907, reiste sie bereits mit Kandinsky durch Europa, Italien und Südfrankreich. Sie besuchte auch Tunis. Sie war in der Lage, ihre Unabhängigkeit zu behaupten, sie fotografierte und malte.
Da sie als Frau nicht an einer Kunstakademie studieren durfte, begann sie ihr Studium an der Damen Akademie in München, die vom Verband der Künstlerinnen geleitet wurde. Anschließend trat sie in die Phalanx-Schule ein, wo sie bei Kandinsky Malerei studierte. Gemeinsam entdeckten sie Murnau und lebten bald gemeinsam - auf einer Katzenpfote - in dem Haus, das Münter gekauft hatte. Dort experimentierten sie mit Marianne von Verefkin, Jawlensky und Kandinsky in der bergigen freien Natur, woraus der deutsche Expressionismus entstand.
Vier Künstler - zwei Paare, von denen nur die Männer in die Kunstgeschichte eingegangen sind. Von Verefkin hörte bald auf zu malen, um nicht mit Jawlenski zu konkurrieren. Münter trat in die Gruppe Der Blaue Reiter ein, aber sie wurde nicht als Gleiche unter Gleichen behandelt. Für ihre Kollegen ist sie keine Malerin, sondern lediglich eine "malende Frau".
Die Ausstellung im Thyssen-Bornemisza-Museum gibt ihr den ihr gebührenden Platz zurück. Man kann die Werke sehen und vergleichen. Es scheint, als hätten sie sich gegenseitig inspiriert und gemeinsam solch kulturell wichtige Entdeckungen gemacht. Die Gemälde zeigen das Innere des Hauses, das tägliche Leben, das in Malerei, Konversation und Arbeit im Garten überging, aber auch die Sammlung von Volkskunst: bayerische Skulpturen und Glasmalereien. Ich kannte die Werke Kandinskys in dieser Technik und brachte sie nur mit ihm in Verbindung. Es stellt sich heraus, dass sie sie entdeckt und gemeinsam experimentiert haben.
Wichtig ist auch, dass das Haus, in dem das alles stattfand, Gabriele Münter gehörte. Sie war diejenige, die die Idee zu dieser Lebensform hatte und nicht ein anderer. Sie war es, die dem Ganzen eine materielle Grundlage gab.
Die Heldinnen
Die Münter-Ausstellung schafft einen neuen Kanon. Wenn ich sie verlasse, habe ich nicht nur Kandinsky, Jawlensky und Franz Marc im Kopf. Sie sind bereits zusammen mit Münter und von Verefkin. Ich werde mich auch an die aggressiven Angriffe von Franz Marc erinnern, der Münter als "einen Floh, der mit dem Blauen Reiter unterwegs ist" bezeichnete. Ich habe zugesehen und weiß, dass sie kein Floh ist.
Das Thyssen-Bornemisza-Museum betreibt diese Art von Politik seit Jahren. Es ist eine bewusste Entscheidung, denn auch die Dauerausstellung hat sich verändert. In der Galerie der Malerei des 20. Jahrhunderts sind Künstler zu sehen, die vorher nicht dort waren. Es geht nicht um Gleichberechtigung, sondern um eine Rückkehr zur Realität nach Jahrzehnten der patriarchalischen Voreingenommenheit. Die Kuratoren waren der Meinung, dass dies ein Teil der Kunstgeschichte ist, der nicht übersehen werden darf.
Temporäre Ausstellungen wie Heroinas (Heroinas; eine Ausstellung, die 2011 vom Thyssen-Bornemisza Museum und der Fundasion Caja Madrid organisiert wurde) oder die jüngste Mistresses (Maestras; eröffnet im Herbst 2023), die Gemälde von Artemisia Gentileschi, Angelika Kaufmann, Clara Peeters, Rosa Bonheur, Mary Cassat, Berthe Morisot, Mari Blanchard, Natalia Goncharova oder Sonia Delaunay zeigt.
Hinzu kommen die Einzelausstellungen. In den letzten Jahren habe ich Georgia O'Keeffe und Artemisia Gentileschi bei Thyssen-Bornemisza gesehen. Gerade die letztgenannte Ausstellung war besonders bewegend. Gentileschi hatte es nicht leicht. Sie lebte dreihundert Jahre vor Münter und die ganze damalige Welt war gegen sie. Sie studierte in der Werkstatt ihres Vaters, des Malers Orazio Gentileschi, der sie Agostino Tassi anvertraute, einem Meister der Perspektive und des Trompe-l'œil. Der Lehrer entpuppte sich als Vergewaltiger. Gentileschi war zu diesem Zeitpunkt achtzehn Jahre alt.
Auf den ersten Blick scheint sie eine Malerin zu sein, die anderen Barockmalern ähnelt: biblische Szenen und Heilige. Betrachtet man jedoch die Auswahl der Motive, so wird es interessanter. Es gibt viele Frauen. Bemerkenswert sind die Gemälde, auf denen Susanna und alte Männer in verschiedenen Darstellungen zu sehen sind. Der Unterschied zu den männlichen Darstellungen der gleichen Themen ist frappierend. Es ist schwierig, neben den alten Männern zu stehen und sich in die Gruppe der Voyeure einzureihen. Unter der Konvention, die die männliche Usurpation und Macht naturalisiert hat, wird die Gewalt sichtbar. Für Gentileschi ist das Thema sexuelle Gewalt und die Situation der Opfer. Man muss es gesehen haben, um zu verstehen, was für eine wichtige Veränderung das ist.
Unter den Protagonisten dieses Gemäldes befinden sich auch Frauen, die selbst zur Gewalt greifen. Judith taucht mehrmals auf, ebenso wie Jael, die den kanaanitischen Häuptling Sisera tötet, indem sie ihm mit einem Zelthering die Schläfe durchbohrt. Wenn man die Geschichte von Gentileschi kennt, fällt es schwer, der Versuchung zu widerstehen, in diesen Szenen nicht nach weiteren Bedeutungen zu suchen. Ein Ausbruch aus der Opferrolle, eine Überschreitung der auferlegten Hierarchien, aber auch eine Vergeltung gegen das Patriarchat, zumindest in der Vorstellung. Ein Kill Bill aus dem siebzehnten Jahrhundert? Ich weiß nicht, wie das zu Artemisia Gentileschis Zeiten funktionierte, aber heute, im Museum Thyssen-Bornemisza, ist diese Malerin ganz sicher kausal. Ihre Stimme ist hörbar geworden. Ich verlasse den Paseo del Prado mit einer neuen Perspektive auf die italienische Seicenta-Kunst und, allgemeiner, auf die Welt, in der ich lebe.
Tyssen-Bornemisza ist nicht die einzige, die auf diese Weise arbeitet. In der Fundación Mapfre war bis zum 5. Januar eine kleine, aber sehr interessante Ausstellung zu sehen, die einem Ereignis vor mehr als 80 Jahren gewidmet war. Im Jahr 1943 organisierte Peggy Guggenheim in ihrer New Yorker Galerie eine der ersten Ausstellungen, die ausschließlich dem Werk von Frauen gewidmet war. Sie zeigte die Werke von 31 Künstlerinnen. Man würde sie gerne alle namentlich erwähnen. Was dabei herauskommt, ist eine nicht ganz so männliche Geschichte des Surrealismus - mit so vergessenen Stars wie Leonor Fini oder Maret Oppenheim. Es ist schwer zu sagen, warum letztere eher als Modell für Man Ray bekannt ist als als eigenständige Künstlerin.
Historisch, nicht hysterisch
Im Jahr 2022 nahm ich an der Manifesta in Madrid teil. Es war schwierig, dorthin zu gelangen, weil die Busse an der Haltestelle in der Nähe unseres Hauses voller Menschen ankamen und nicht einmal anhielten. Ich hatte den Eindruck, dass die ganze Stadt in das Zentrum strömte. Und das war tatsächlich der Fall. Die Straßen, die zum Bahnhof Atocha führen, waren blockiert, der Bus setzte uns früh ab, und wir liefen mit einer ziemlich bunten Menschenmenge, um bis zum südlichen Ende der Demonstration zu gelangen. Ein Treffen mit Freunden, die von der anderen Seite kamen, kam nicht in Frage. Die Versammlung erstreckte sich bis nach Cibeles, etwa zwei Kilometer weiter nördlich.
Wir gingen mit Mirka - meiner Tochter - zwischen den Leuten umher und unterhielten uns. Wir trafen dort zwei Mädchen, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Sie hielten Transparente in der Hand. Auf dem ersten war die Aufschrift zu lesen: "No somos hystericas, somos historicas", was bedeutet: "Wir sind nicht hysterisch, wir sind historisch". Historisch in einem doppelten Sinne: nicht nur als vollwertige Teilnehmer an der Geschichte der Vergangenheit und der Gegenwart, sondern auch als diejenigen, die gerade jetzt eine Revolution machen. Eine lange Revolution, die systematisch und hoffentlich effektiv durchgeführt wird. Auf dem zweiten Transparent war zu lesen: "Lo contrario del feminismo es ignorancia", d.h. "Das Gegenteil von Feminismus ist Ignoranz".
Dem ist nichts hinzuzufügen, dem ist nichts hinzuzufügen. Die Spanier können sich glücklich schätzen, dass die Slogans dieser Mädchen für fast jeden offensichtlich geworden sind. Sie werden auch von Institutionen wie Thyssen-Bornemisza oder der Fundación Mapfre umgesetzt, und das wundert niemanden. Auch Trump wird sie nicht aufhalten.