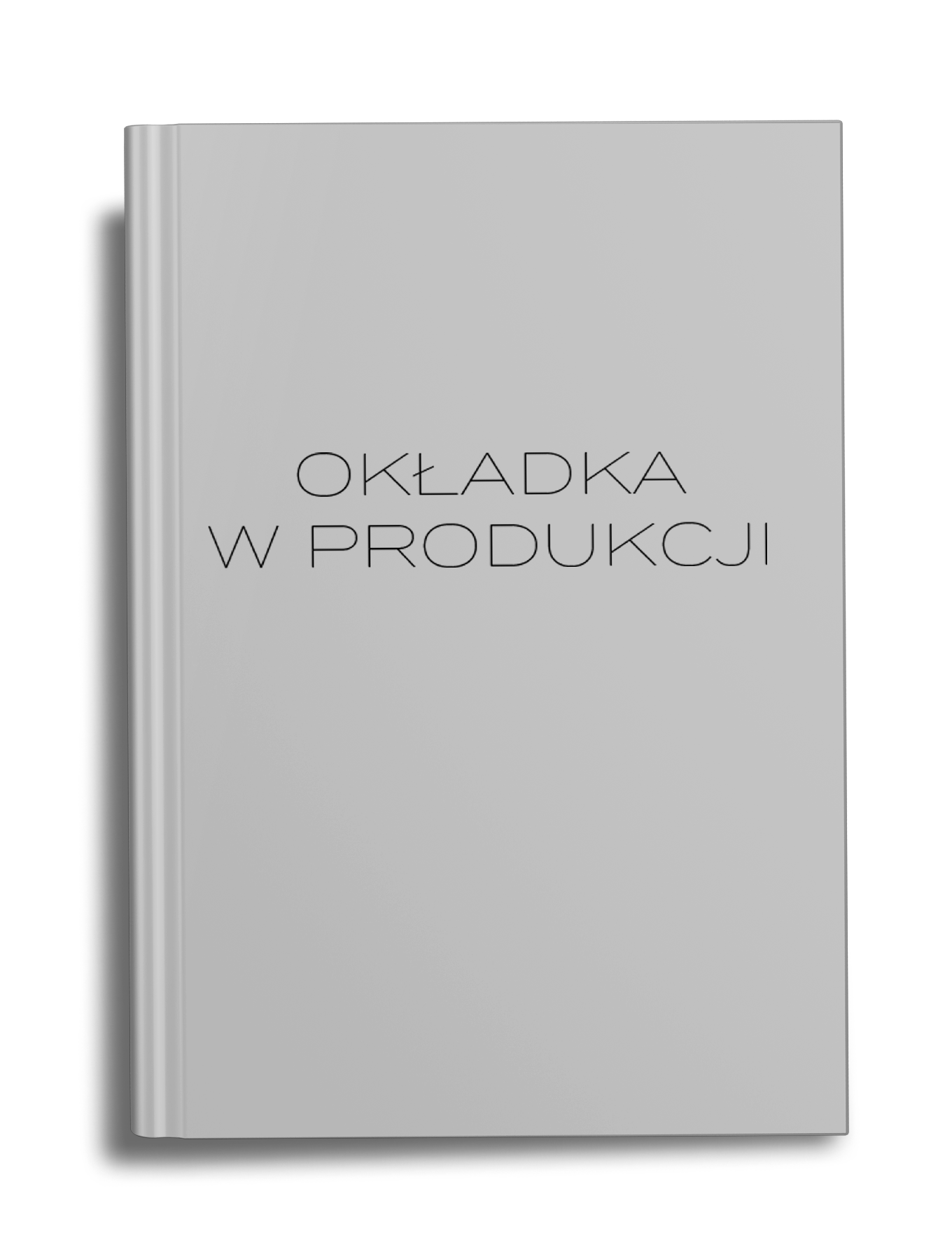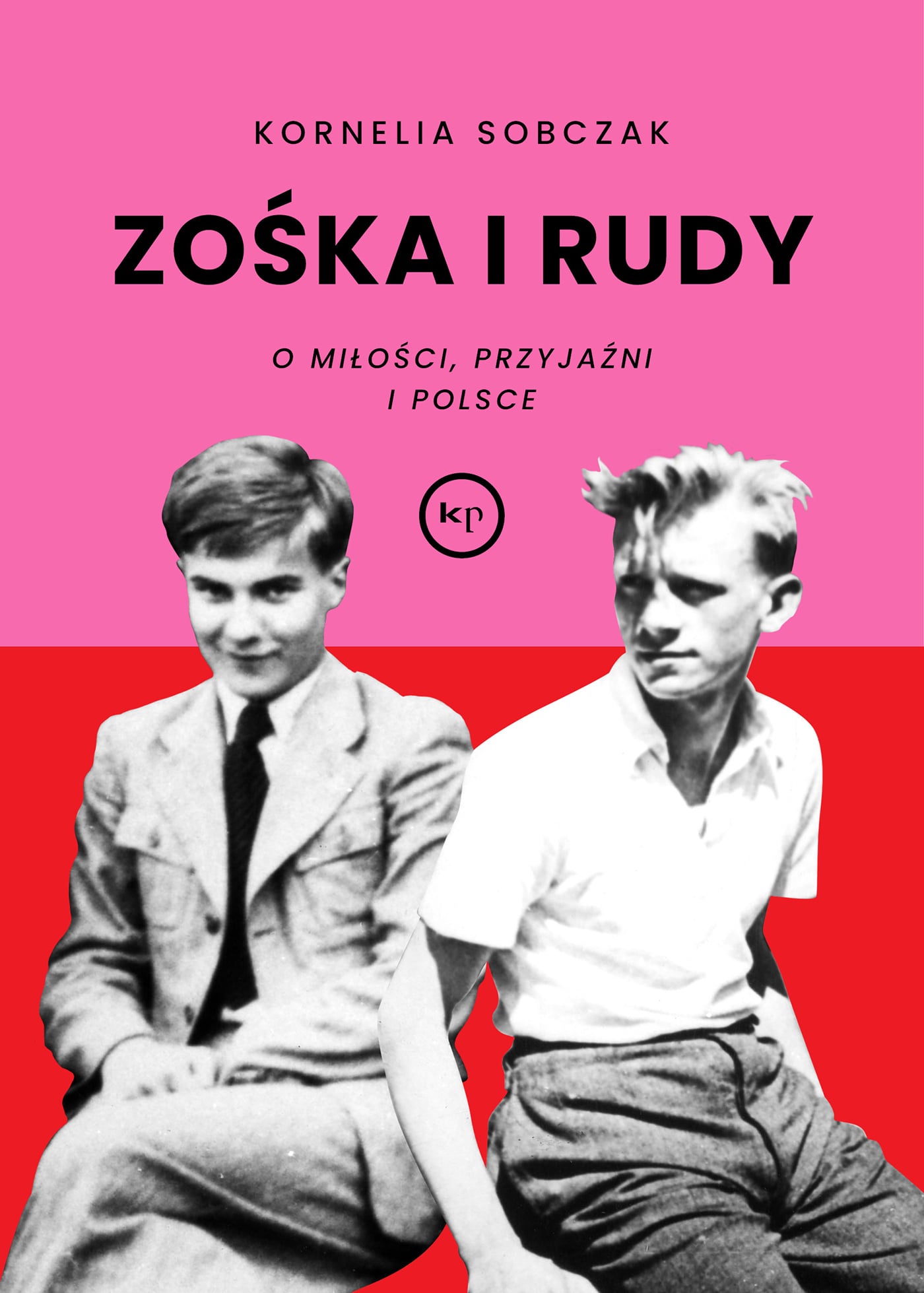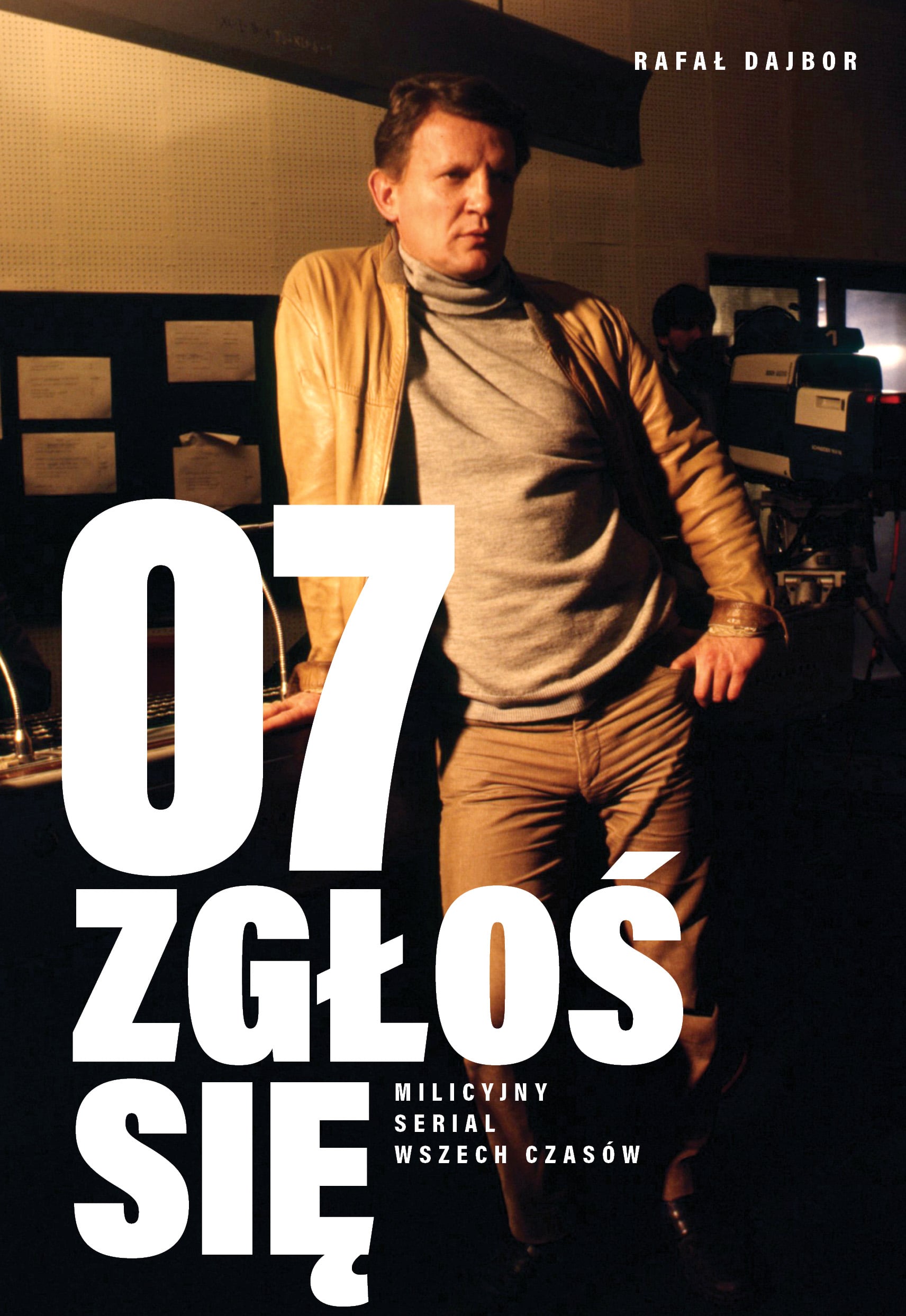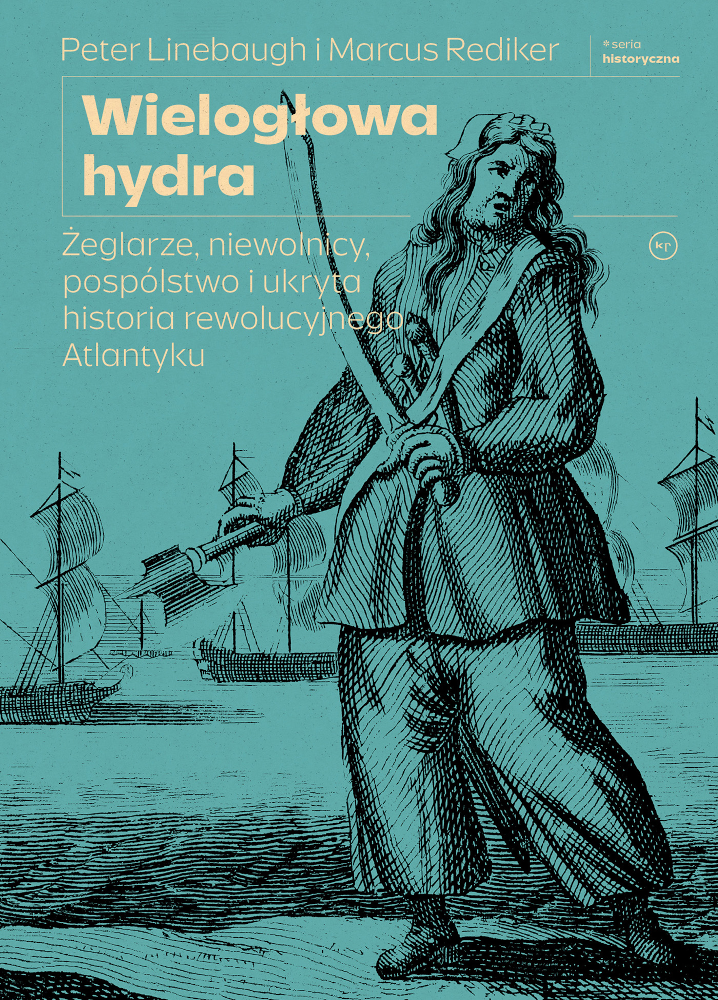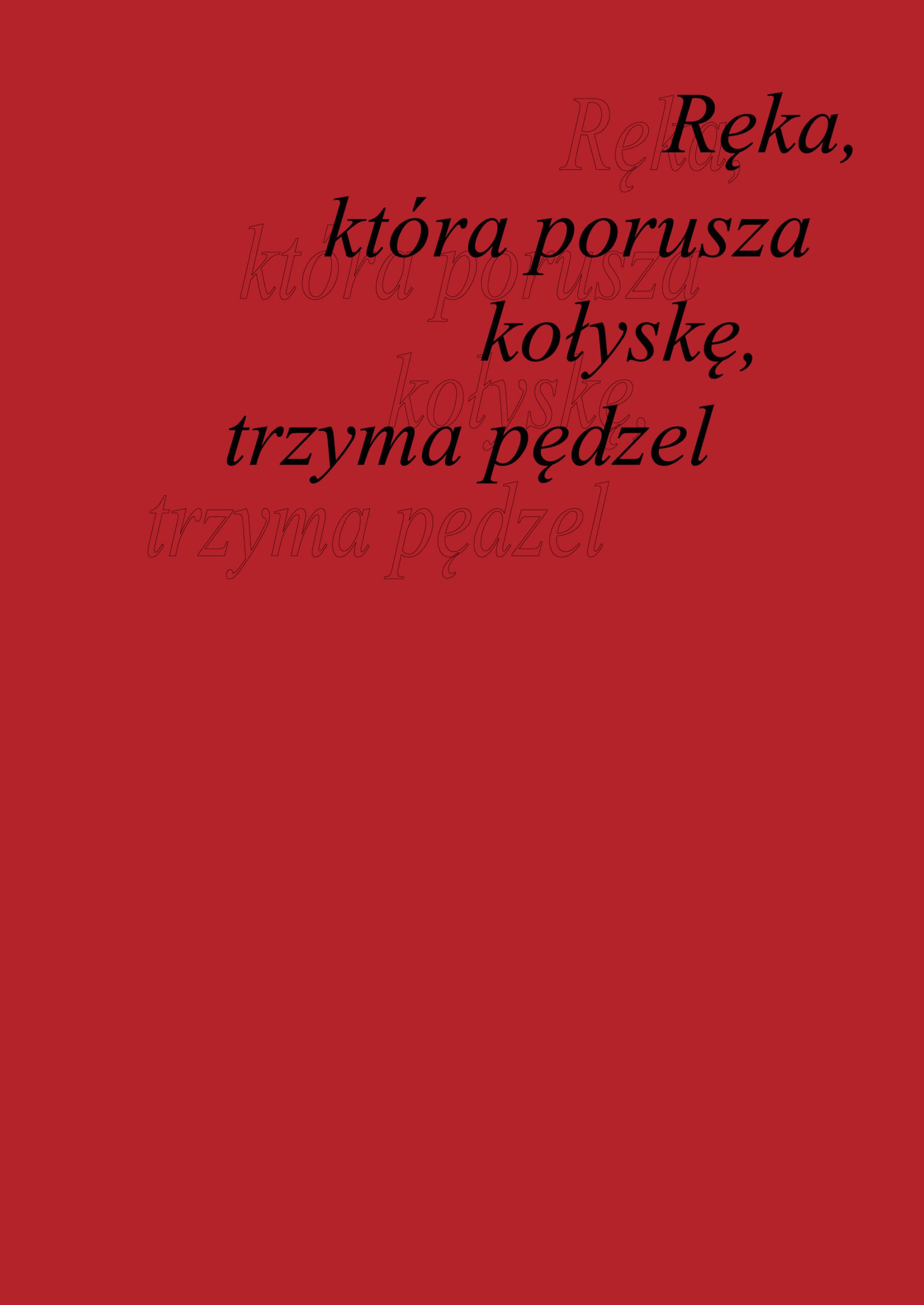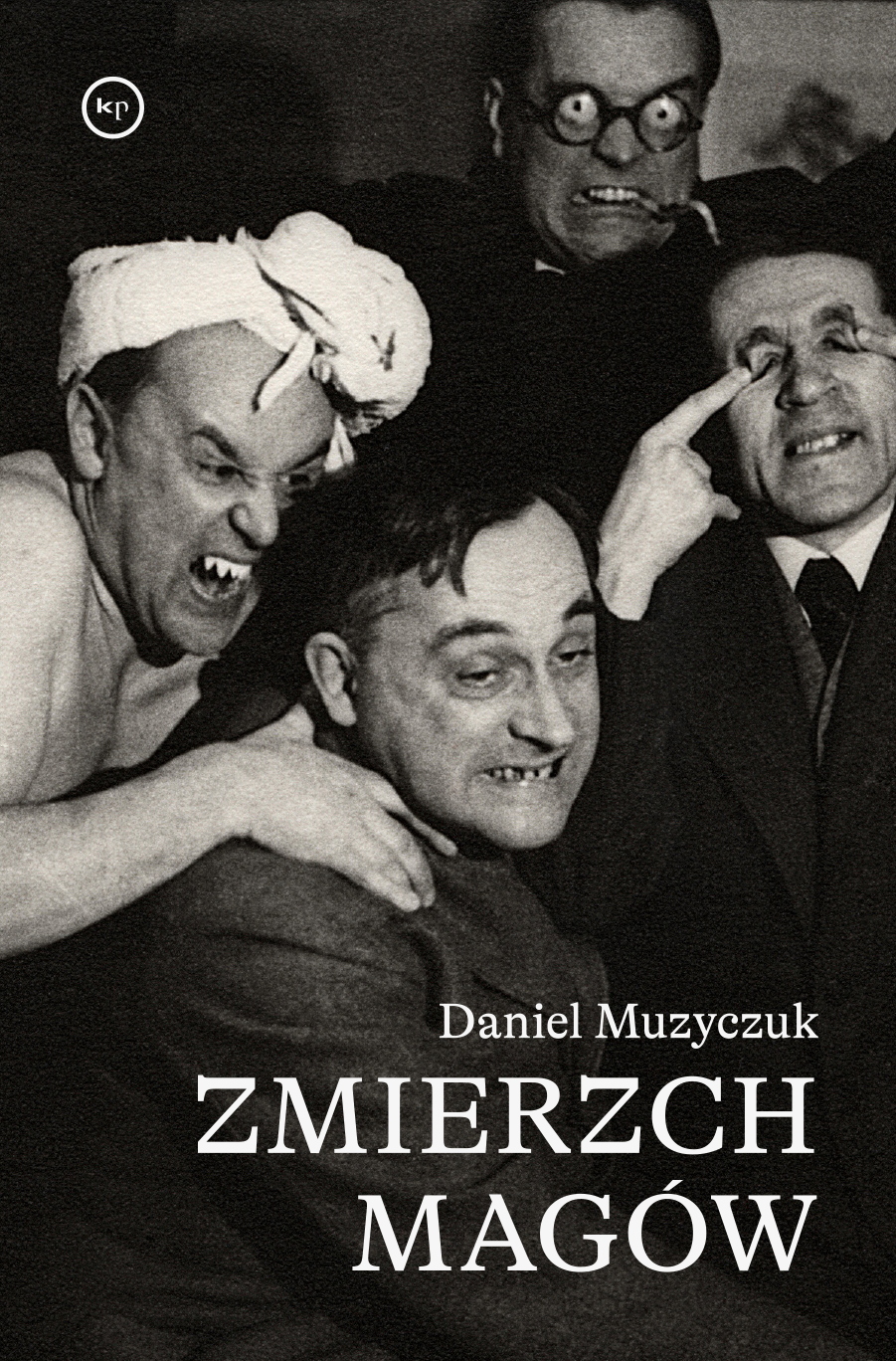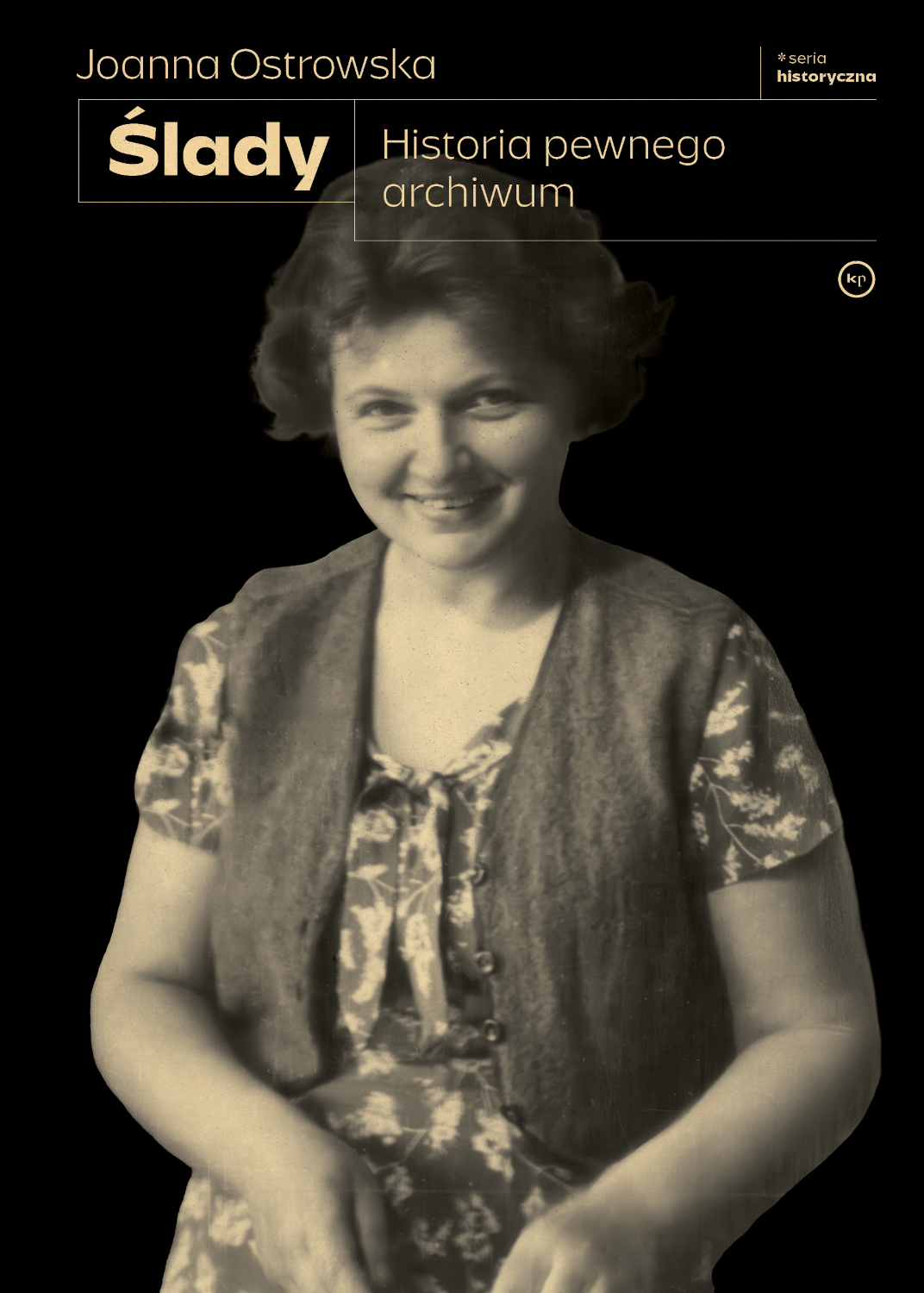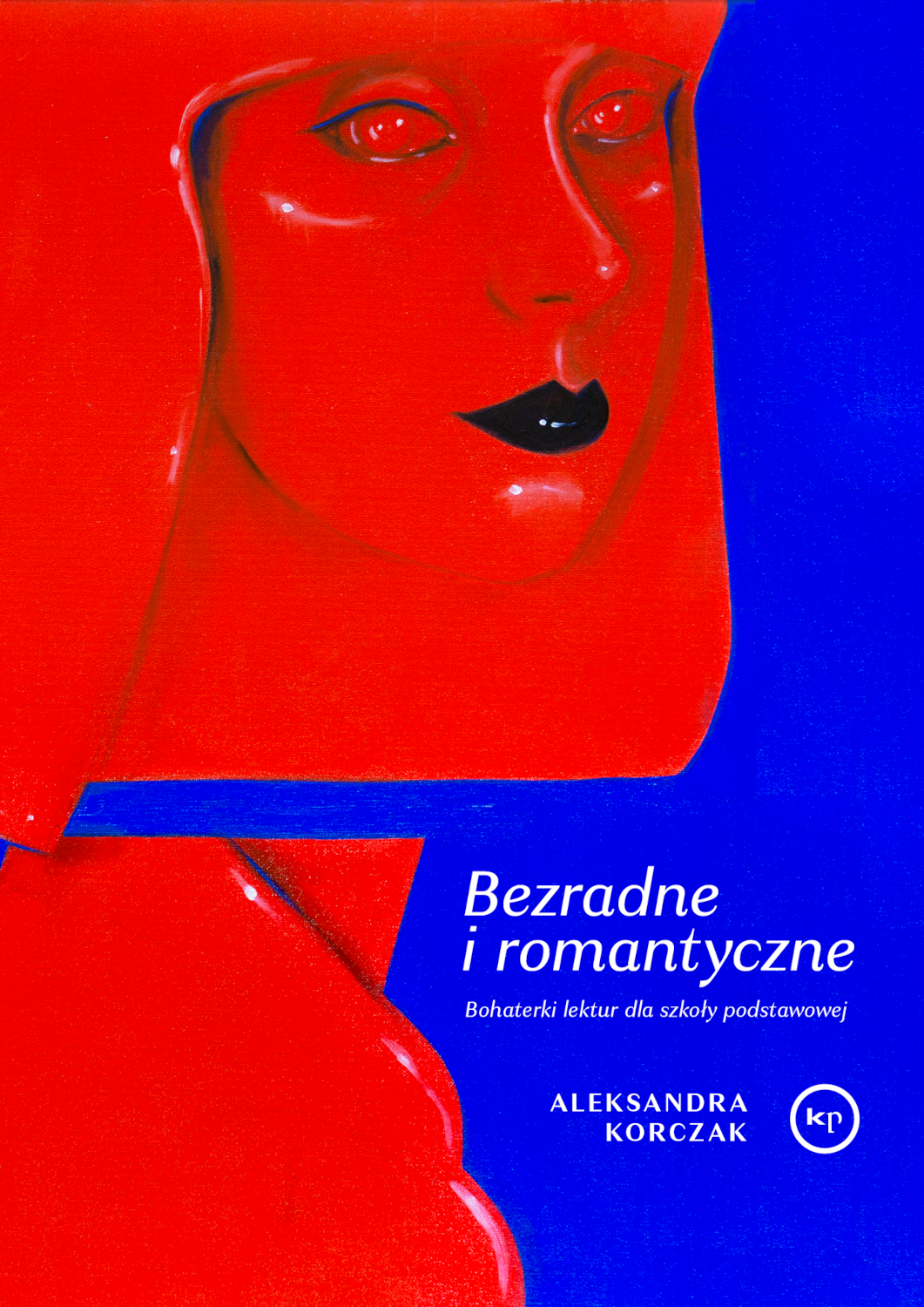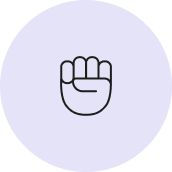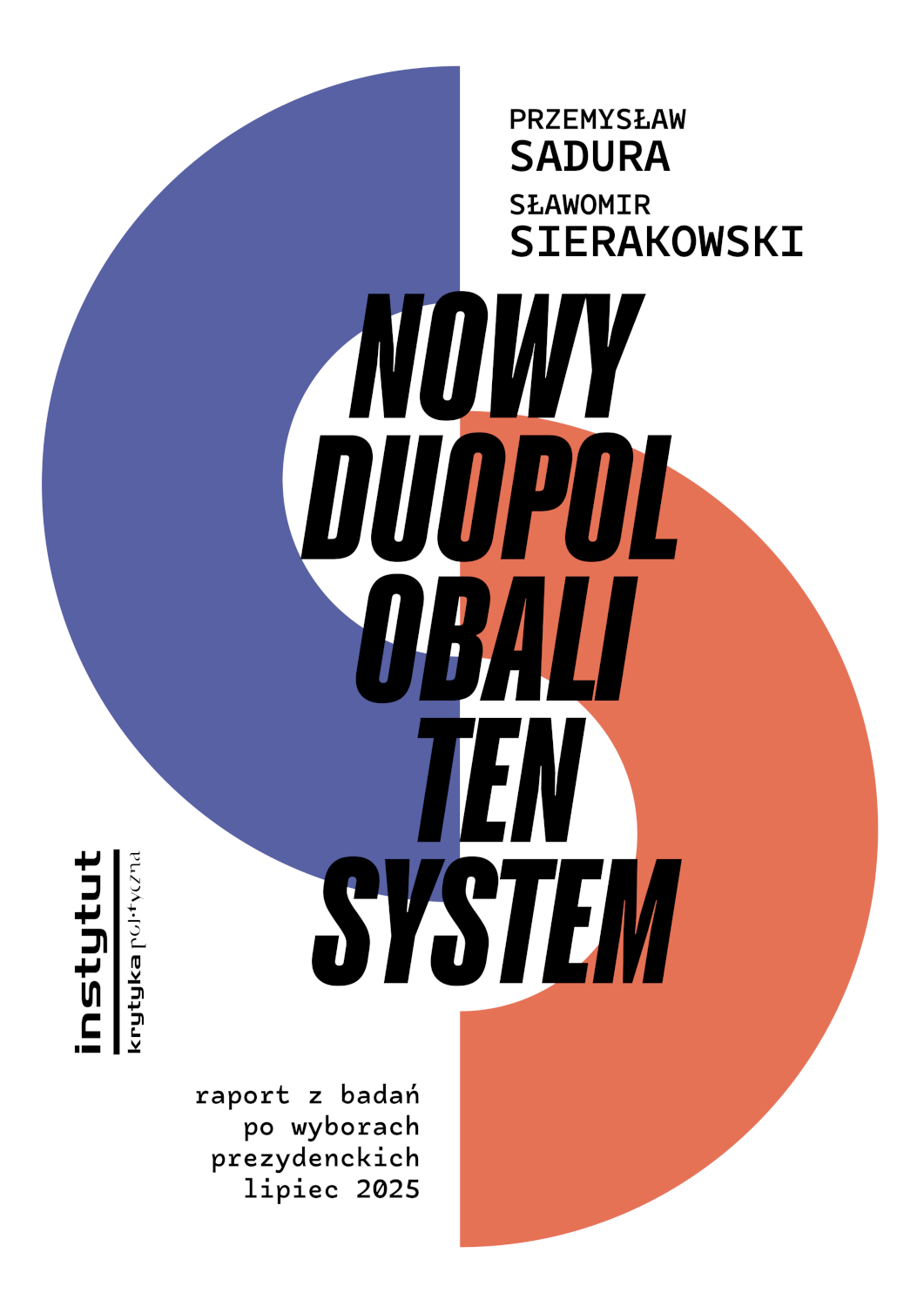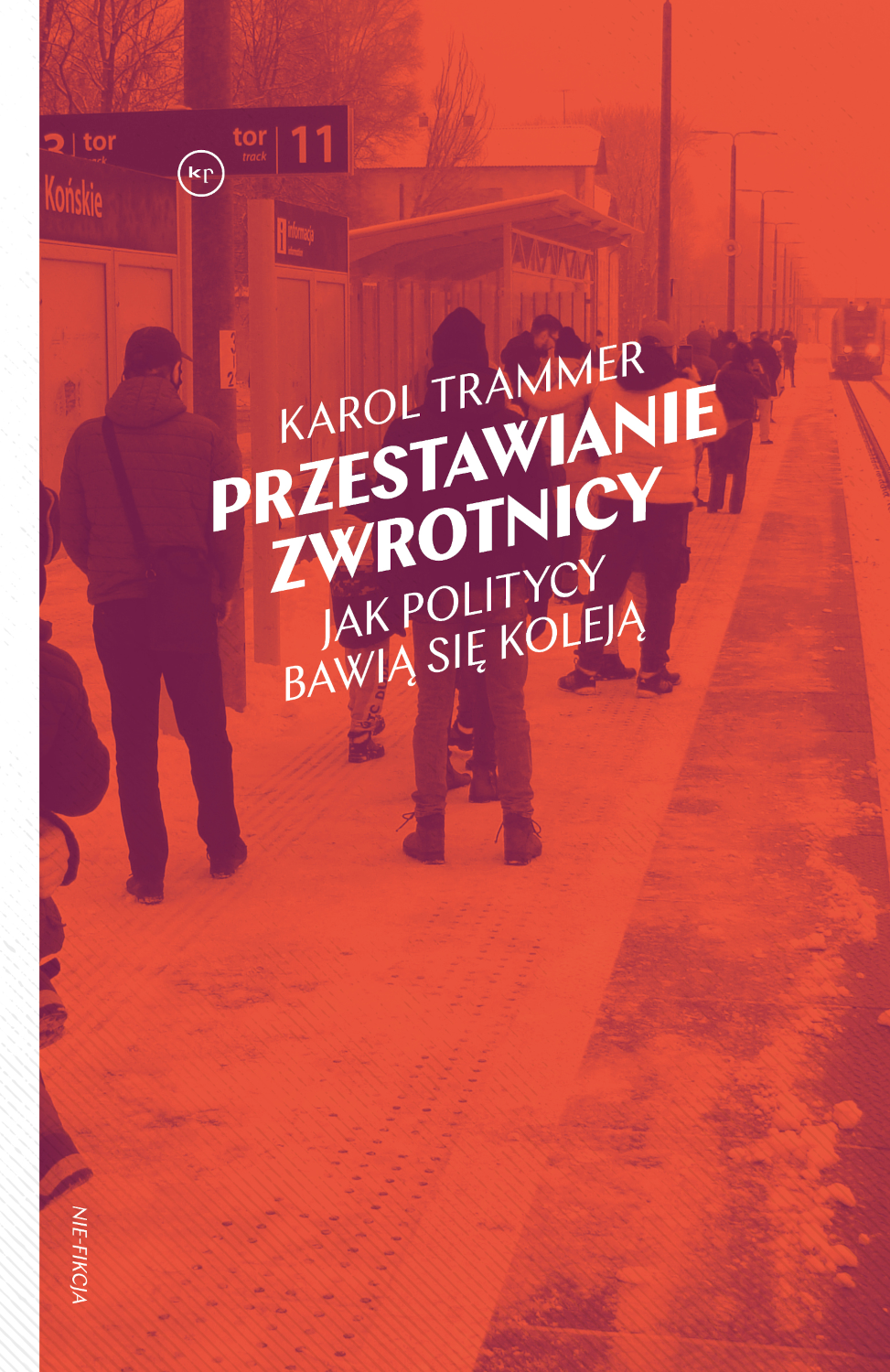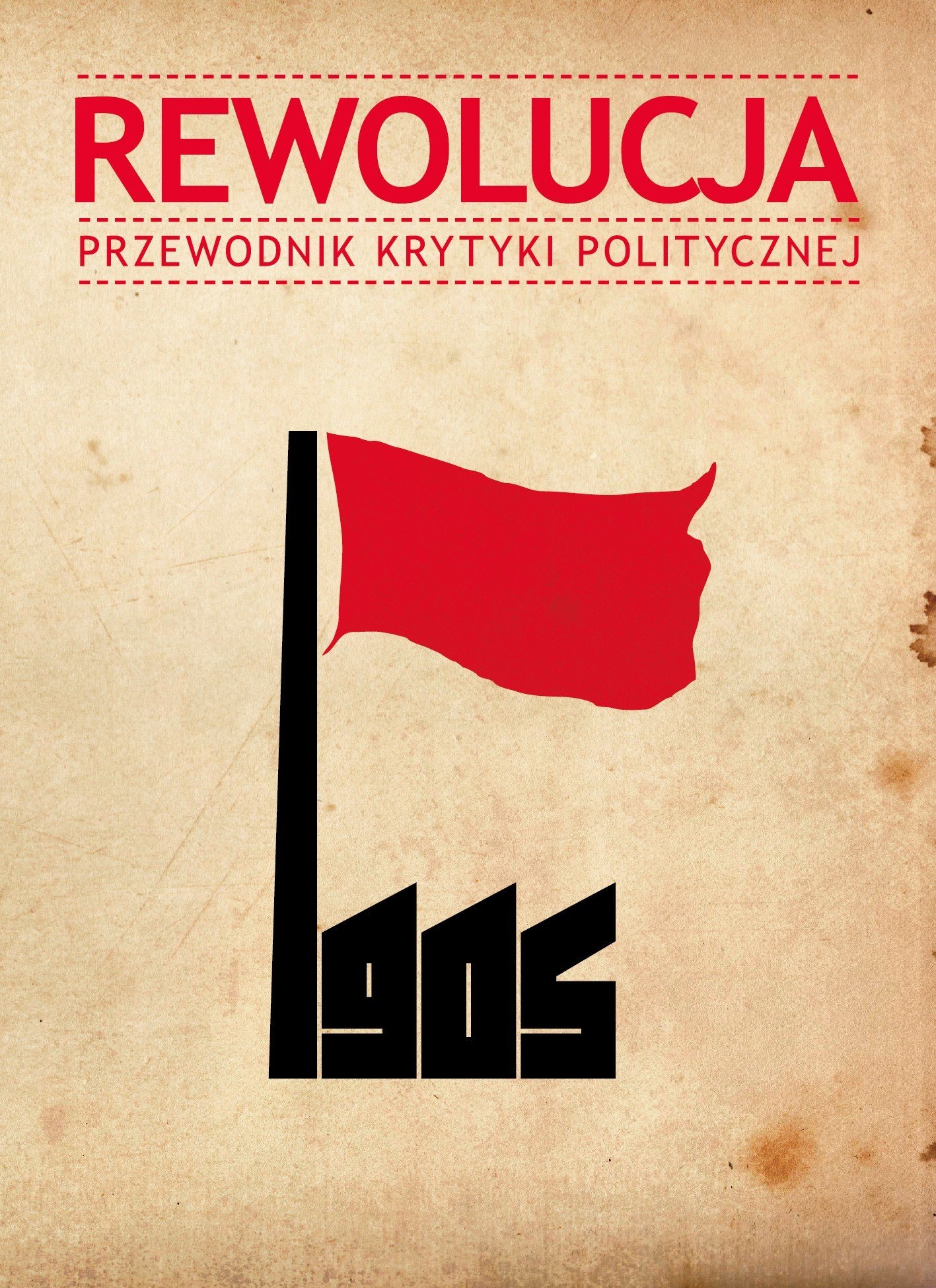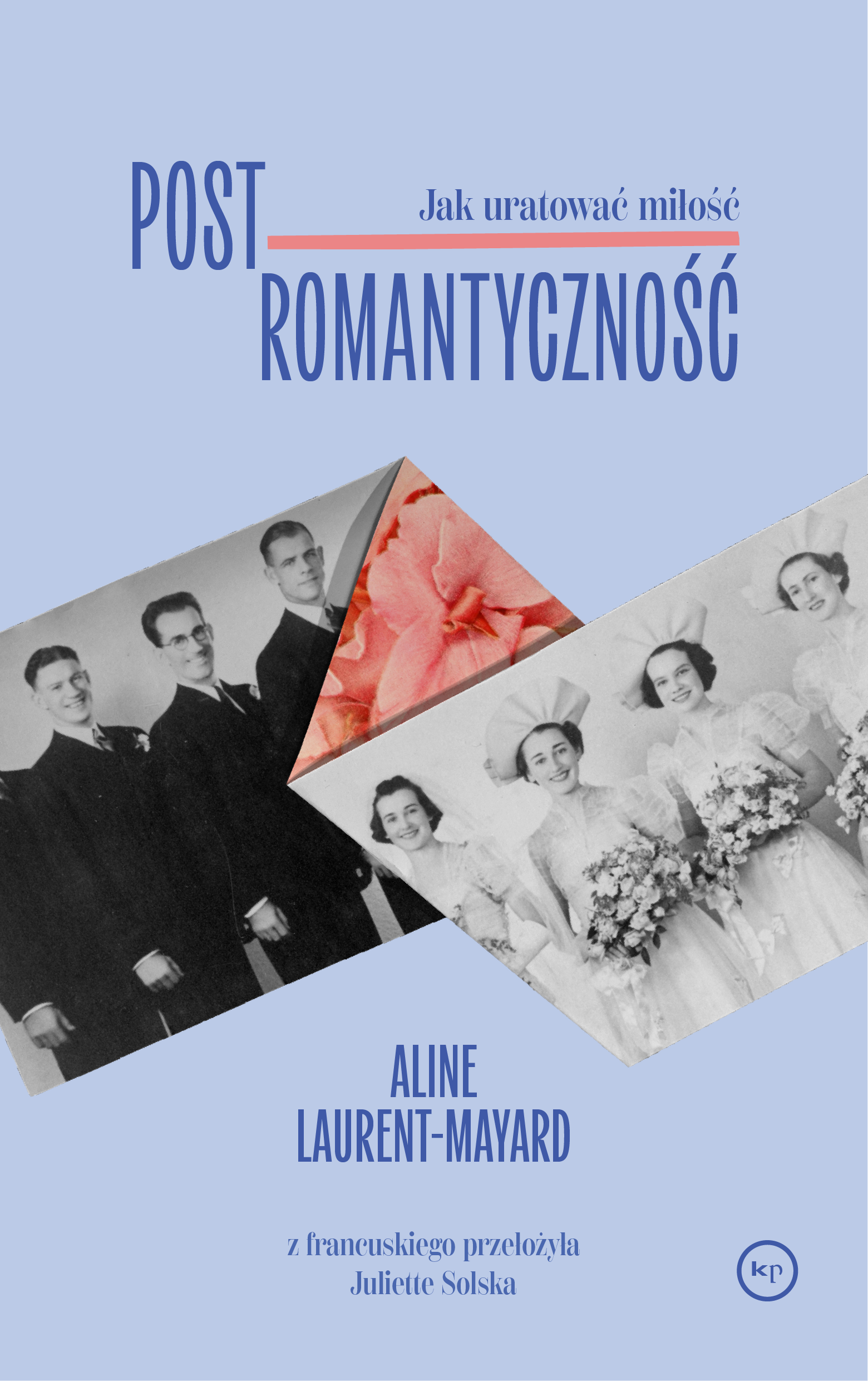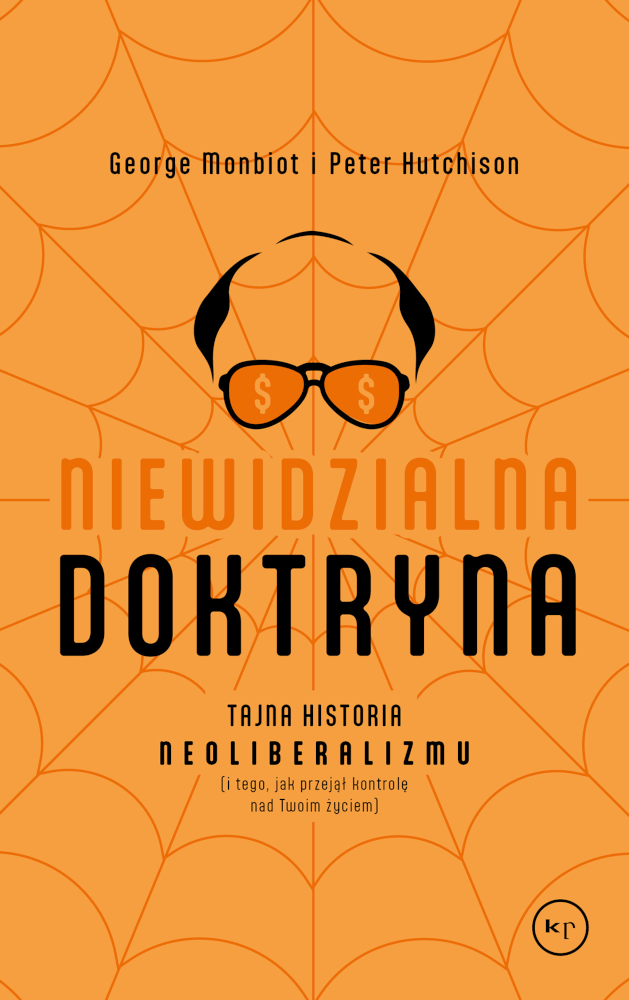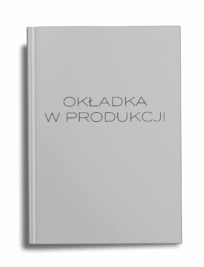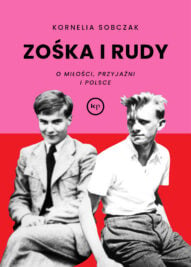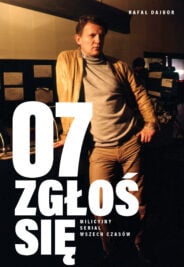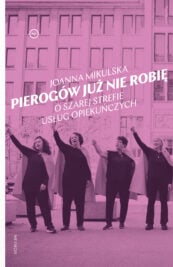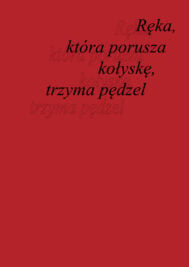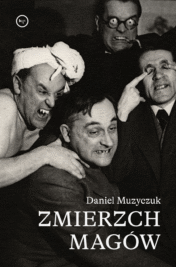Niezwykle kontrowersyjne wypowiedzi Donalda Trumpa na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie, jakby Stany Zjednoczone chciały się „wymigać” od zobowiązań sojuszniczych i zostawić Europę samą sobie.
Zapowiedzi przejęcia kontroli nad Grenlandią, nie wykluczając przy tym użycia siły, podważają przecież istnienie NATO. Gdyby wojsko USA anektowało należące do Danii terytorium, Polska teoretycznie musiałaby bronić swojego ważnego europejskiego sojusznika przed agresją swojego kluczowego gwaranta bezpieczeństwa. Trudno sobie wyobrazić mniej komfortową sytuację dla Polski, w której stacjonuje ok. 10 tys. amerykańskich żołnierzy. Gdyby do tego doszło, Sojusz Północnoatlantycki stałby się fikcją.
Kamienie obrazy
Radykalnie asertywne, żeby nie powiedzieć brutalne, zachowanie Trumpa wobec swoich sojuszników można też jednak interpretować jako próbę wyrąbania sobie znacznie lepszej pozycji USA w strukturach Zachodu. Środowisko polityczne obejmujące władzę nad Potomakiem na długi czas przed zwycięskimi wyborami dawało głośno znać, że obecny globalny układ ekonomiczny i geopolityczny jest dla USA niekorzystny. Teza ta opiera się na dwóch filarach.
Pierwszym z nich są relacje gospodarcze z kluczowymi partnerami handlowymi – USA od lat notują deficyt handlowy, importując znacznie więcej, niż sprzedają za granicę. To pociągnęło za sobą wyprowadzenie części przemysłu do tańszych regionów świata – głównie do Chin, ale też do Meksyku czy Europy Środkowo-Wschodniej.
W rezultacie klasa pracująca doznała pauperyzacji, a niegdyś całkiem zamożne stany USA, których gospodarka opierała się na produkcji, przeżyły głęboką zapaść. Najbardziej dobitnym przykładem jest stan Michigan, który w krótkim czasie spadł do poziomu biednej od lat Luizjany, a jego największe miasto, Detroit, jest obecnie symbolem postindustrialnej degradacji, niczym Wałbrzych w latach 90. w Polsce.
Drugim filarem teorii o niekorzystnym położeniu globalnego hegemona – co zresztą już na pierwszy rzut oka wygląda na oksymoron – są koszty obecności sił amerykańskich w Europie i szerzej, pełnienia funkcji głównego gwaranta bezpieczeństwa na Starym Kontynencie.
Trump wiele razy powtarzał, że znaczna część członków NATO nie wydaje na armię 2 proc. PKB, do czego zobowiązuje je Pakt Północnoatlantycki. Wiele osób z jego środowiska jest przekonanych, że UE wręcz żeruje na USA, wykorzystując obecność Amerykanów w Europie do zaniżania wydatków na wojsko. Wiceprezydent J.D. Vance na łamach „Financial Times” wystawił nawet Europie rachunek.
„Według szacunków kontynent wydałby dodatkowe 8,6 biliona dolarów na obronę w ciągu 30 lat, gdyby utrzymał poziom wydatków wojskowych z czasów zimnej wojny. Ponieważ amerykański budżet obronny zbliża się do biliona dolarów rocznie, powinniśmy postrzegać pieniądze, których Europa nie wydała na obronę, jako podatek od narodu amerykańskiego na zapewnienie bezpieczeństwa w Europie” – napisał Vance w lutym 2024 roku.
Inaczej mówiąc, Ameryka zaczęła postrzegać stworzony de facto przez siebie Pax Americana jako strukturę wyzyskującą USA i bardzo niesprawiedliwą dla Waszyngtonu. Nawet jeśliby tak było, to pretensje powinna mieć przede wszystkim do siebie.
Obrażony hegemon
To właśnie USA jako zwycięzca II wojny światowej ustanowiły filary obecnego porządku międzynarodowego. Nie chodzi tu wcale o słynną Jałtę, w której dopięto przekazanie całej Europy Środkowo-Wschodniej pod kuratelę ZSRR, lecz o system stworzony podczas konferencji w Bretton Woods.
W wyniku ustaleń podjętych jeszcze w 1944 roku w tej niewielkiej miejscowości w stanie New Hampshire powstały kluczowe organizacje finansowe – Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy – w których Amerykanie zapewnili sobie dominującą pozycję. Najważniejszym skutkiem wprowadzenia systemu Breton Woods było jednak objęcie przez dolara funkcji globalnej waluty rezerwowej, względem której wszystkie banki centralne musiały utrzymywać określony kurs wymiany.
System ten został częściowo rozmontowany przez administrację Nixona, która na początku lat 70. zrezygnowała z wymienialności dolara na złoto. Było to w tamtym czasie szokujące, jednak w dłuższej perspektywie niewiele zmieniło – dolar amerykański utrzymał swoją pozycję absolutnie kluczowej waluty świata. Okazało się, że zaufanie do niego było efektem zaufania do amerykańskiego państwa, a nie do złotego kruszcu.
Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego na koniec zeszłego roku dolar odpowiadał za 57 proc. globalnych rezerw walutowych. Drugie w kolejności euro – za 20 proc. Amerykańska waluta ma więc pod tym względem trzykrotnie większe znaczenie niż wspólna waluta europejska. Pozostałe, takie jak chiński juan, japoński jen, funt czy nawet słynny frank szwajcarski, kompletnie się już w tej stawce nie liczą, mając po kilka procent udziału.
Dzięki temu USA mają pewność, że wartość ich waluty jest bezpieczna i stabilna, pomimo bardzo ekspansywnej polityki Rezerwy Federalnej, która przez wiele lat stosowała agresywne luzowanie ilościowe, prowadzące do zwiększania ilości pieniądza w obiegu, nie musząc się szczególnie martwić o inflację.
Drugim przejawem hegemonii dolara jest jego udział w transakcjach międzynarodowych. Według analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z lutego zeszłego roku, autorstwa Piotra Dzierżanowskiego, w 2023 roku niemal połowa transakcji zawieranych w międzybankowym systemie SWIFT opierała się na dolarze. Euro wykorzystywano przy 23 proc. transakcji, a pozostałe waluty miały już marginalne znaczenie.
FED nie musi się więc martwić o wartość emitowanej przez siebie waluty, gdyż chętnych do jej zakupu nie brakuje. Dzięki temu może stosować niskie stopy procentowe, co zapewnia Amerykanom dostęp do tanich kredytów. Czasem aż zbyt tanich, co skończyło się kryzysem na rynku hipotek z 2008 roku, który szybko zmienił się w ogólny kryzys finansowy i rozlał się na cały świat, doprowadzając między innymi do ekonomicznego upadku Grecji.
Dzięki dominacji dolara Amerykanie mogą cieszyć się nie tylko tanimi kredytami, ale też niskimi cenami wszystkiego innego. W czasie niedawnego kryzysu kosztów życia inflacja w USA nie przebiła 10 proc., chociaż w UE w niektórych państwach (Węgry i państwa bałtyckie) zbliżała się do 25 proc. W czerwcu 2022 roku osiągnęła szczytowe 9 proc., ale w kolejnych miesiącach szybko spadała i już rok później wynosiła 3 proc.
Dzięki posługiwaniu się na co dzień globalną walutą rezerwową Amerykanie mogą kupować na potęgę dobra wyprodukowane w innych krajach w niskich cenach. USA są największym światowym importerem – według danych banku PKO BP w 2023 roku zakupiły za granicą towary warte niemal 3 biliony euro. Najwięcej z Meksyku (443 mld euro), Chin (414 mld euro) i Kanady (niemal 400 mld), której Trump grozi właśnie nałożeniem surowych ceł (ale zapewnia łaskawie, że w przeciwieństwie do Grenlandii nie użyje wobec niej sił wojskowych).
Pod względem eksportu USA wypadają już znacznie słabiej. W 2023 roku wyeksportowały towary warte niespełna 1,9 bln euro. Najwięcej produktów made in USA zakupiła Kanada (326 mld euro), Meksyk (niemal 300 mld) oraz Chiny (137 mld). Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę Unię Europejską jako całość, to właśnie Europa staje się największym partnerem handlowym USA.
Według danych Eurostatu w 2023 roku UE odpowiadała za 346 mld euro amerykańskiego eksportu oraz nieco ponad pół biliona amerykańskiego importu. W relacjach handlowych z Unią Europejską USA zanotowały aż 156 mld euro deficytu. Tylko z Chinami deficyt handlowy USA był większy – i to znacznie, gdyż w tym przypadku mowa aż o 277 mld dolarów pod kreską.
W ten sposób USA mogą bez ryzyka makroekonomicznego przez długie lata notować wysoki deficyt rachunku bieżącego (coroczne przepływy finansowe kraju z zagranicą). Od początku lat 90. USA nieustannie są pod kreską – według danych OECD, na koniec 2023 roku zanotowały deficyt rzędu 3 proc. PKB. Średnia OECD wyniosła równe zero, natomiast Unia Europejska zaliczyła nadwyżkę na poziomie 2 proc. PKB.
Trumpowskie manipulacje
To właśnie ten deficyt handlowy jest według Trumpa dowodem na wyzyskiwanie USA przez inne czołowe gospodarki globu. To jednak jawna manipulacja – deficyt jest skutkiem dominującej pozycji dolara, co umożliwia Amerykanom i amerykańskim przedsiębiorstwom kupowanie za granicą na potęgę.
Według trumpistów obecny kształt relacji handlowych doprowadził do wyprowadzki milionów miejsc pracy poza USA, czego skutkiem jest pauperyzacja klasy pracującej – szczególnie w tak zwanym Pasie Rdzy, czyli niegdyś uprzemysłowionych stanach (wspomniane już Michigan, Indiana i Ohio – rodzinny stan J.D. Vance’a). Ten trwający od kilku dekad offshoring jest jednak skutkiem liberalizacji światowego handlu, co umożliwiło przenoszenie produkcji do krajów z niższymi kosztami pracy. A kto stoi za tą liberalizacją? Oczywiście USA, które przynajmniej od lat 70. bardzo intensywnie promowały wolny handel na świecie, czego efektem utworzenie między innymi Światowej Organizacji Handlu, która stoi na straży niskich ceł.
Utworzenie WTO poprzedziła cała seria konferencji Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), podczas których dominujące USA wymuszały obniżanie stawek celnych. Oficjalnie w celu promowania wolnego handlu, w rzeczywistości jednak w celu uniemożliwienia stosowania protekcjonizmu przez tygrysy gospodarcze z różnych części świata.
Przykładowo podczas tokijskiej rundy negocjacji GATT (1973–1979) USA wybiły zęby szybko rosnącej Japonii, obniżając dopuszczalne cła na artykuły przemysłowe z 33 do 6 proc. W rezultacie tych wszystkich uzgodnień oraz finalnego utworzenia WTO obecnie państwa chcące uczestniczyć w globalnym handlu formalnie nie mogą prowadzić polityki przemysłowej na wzór Korei Południowej lub Tajwanu, które stosując wysokie cła i subsydia eksportowe, szybko rozwinęły swój przemysł, dzięki czemu należą obecnie do czołowych eksporterów towarów zaawansowanych.
Niemcy biedniejsze niż Luizjana? To bardziej skomplikowane
Amerykanie najpierw stworzyli współczesny kształt relacji ekonomicznych na świecie, a teraz oskarżają inne państwa, że niektóre jego aspekty są dla nich niekorzystne. Trudno o większą hipokryzję.
Oczywiście, że współczesny ład globalny ma też z punktu widzenia Amerykanów wady. Utrata części miejsc pracy w przemyśle to jedna z nich – to jednak USA naciskały na liberalizację światowego handlu, co umożliwiło ekspansję ich firmom, blokując przy tym możliwość spokojnego wzrastania raczkującym przedsiębiorstwom z krajów rozwijających się.
Faktem jest też to, że USA cierpią obecnie na ogrom problemów wewnętrznych. Pauperyzacja klasy pracującej, epidemia opioidowa, przestępczość, gigantyczny wskaźnik zabójstw czy brak dostępu do opieki medycznej najmniej zamożnej części społeczeństwa to tylko kilka z nich. Niemal wszystkie patologie trapiące USA są jednak skutkiem krajowych rozwiązań systemowych, przyjętych przez Amerykanów i utrzymywanych za wszelką cenę.
Pod względem dochodu na głowę USA są jednym z najbogatszych krajów świata. Według danych MFW w zeszłym roku osiągnęły one PKB rzędu aż 87 tys. dol. per capita, co dało im ósme miejsce na świecie, chociaż liczą aż 335 mln mieszkańców. Przed nimi znajdują się wyłącznie małe lub wręcz mikroskopijne kraje, leżące na ropie lub gazie albo będące rajami podatkowymi – Brunei, Szwajcaria, Norwegia, Katar, Irlandia, Singapur i Luksemburg.
Pomijając raje podatkowe Irlandię i Luksemburg, nawet najbogatsze państwa UE, Dania i Holandia, są przeciętnie mniej zamożne niż ogromne USA – zanotowały odpowiednio 83 i 81 tys. dochodu na głowę. Gdyby je porównać do poszczególnych stanów, to Dania nie zmieściłaby się do pierwszej dwudziestki pod względem zamożności. Dwudziesty stan New Hampshire w 2024 roku zanotował PKB na głowę rzędu 85 tys. dolarów. Niemcy z wynikiem niespełna 71 tys. dol. per capita znalazłyby się wśród najbiedniejszych stanów USA, zaraz pod Luizjaną (38 miejsce), która w popkulturze jest regularnie wykorzystywana do przedstawiania biedy i patologii społecznych w USA. Tymczasem Niemcy teoretycznie są jeszcze biedniejsze.
Teoretycznie, gdyż standard życia nie jest określany przez samo PKB na głowę, często sztucznie napompowane przez zyski firm. Tak jak ma to miejsce w Irlandii, która według PKB na głowę należy do absolutnego topu bogaczy, gdyż swoje zyski rozliczają tam amerykańskie spółki korzystające z niskiego opodatkowania – a sami mieszkańcy są biedniejsi choćby od wspomnianych Niemców.
Nie zmienia to faktu, że pieniędzy w USA jest w bród. Płyną tam szerokim strumieniem i to od Amerykanów zależy, w jaki sposób są dystrybuowane. Tymczasem nierówności w USA są gigantyczne – według OECD wskaźnik Giniego wynosi tam 0,4, co jest drugim najwyższym wynikiem po Kostaryce. Według World Inequality Database w USA najlepiej zarabiające 10 proc. zgarnia niemal połowę wypracowywanych nad Potomakiem dochodów. W krajach UE, w tym w Polsce, jest to zwykle ok. jednej trzeciej.
Co zyskuje szeryf
USA korzystają nie tylko na stworzonym przez siebie światowym porządku ekonomicznym, ale też na pełnieniu funkcji globalnego szeryfa. Owszem, według danych NATO są wśród liderów pod względem nakładów na zbrojenia. W 2024 roku wydawały niespełna 3,5 proc. PKB, co dało im trzecie miejsce, po Estonii (niemal równe 3,5 proc.) oraz Polsce (ponad 4 proc.), która zdecydowanie przoduje.
Mediana wydatków na zbrojenia w NATO wyniosła w 2024 roku 2,11 proc. PKB, więc większość państw Sojuszu wypełnia już zobowiązania pod tym względem. Jeśli chodzi o udział wydatków na sprzęt, państwa członkowskie wypełniają swoje zobowiązania z nawiązką. Powinny wydawać na sprzęt przynajmniej 20 proc. swoich budżetów, tymczasem mediana wynosi 31 proc., a USA są pod tym względem nawet minimalnie poniżej (równe 30 proc.). W tym przypadku znów przoduje Polska (ponad 50 proc.), a zobowiązań nie dotrzymują tylko dwa państwa – Kanada (niespełna 20 proc.) i Belgia (15 proc.).
Trudno jednak nie zauważyć, że olbrzymia część tych wydatków wojskowych państw członkowskich trafia do USA, które są przecież czołowym eksporterem broni na świecie. Według danych amerykańskiego Departamentu Stanu w 2023 roku USA sprzedały za granicę broń wartą aż 81 mld dolarów, co oznaczało wzrost rok do roku o… 56 proc.
Wśród czołowych nabywców znajduje się oczywiście Polska, która zakupiła między innymi śmigłowce Apache (12 mld dolarów), wyrzutnie Himars (10 mld) czy czołgi Abrams (3,75 mld). Oprócz Polski na liście czołowych kupców jest też jednak wiele innych krajów Europy – Niemcy (śmigłowce Chinook – 9 mld oraz pociski AMRAAM za 3 mld), Czechy (myśliwce F-35 – 5,6 mld), Bułgaria (wozy opancerzone Stryker – 1,5 mld) czy Norwegia (zaopatrzenie do śmigłowców MH-60R – 1 mld).
Inaczej mówiąc, Amerykanie domagający się zwiększenia nakładów na zbrojenia tak naprawdę domagają się większych zakupów broni od ich przedsiębiorstw. Amerykańska broń jest tak popularna wśród państw NATO nie tylko dlatego, że jest tak dobra – chociaż niewątpliwie jest. Przede wszystkim gwarantuje ona kompatybilność z siłami kluczowego członka NATO, jakim są USA.
Jeśli Stany Zjednoczone przestaną odgrywać rolę gwaranta bezpieczeństwa w Europie, ich przemysł zbrojeniowy straci wielu klientów. W tym Polskę, która w takiej sytuacji mogłaby przesunąć część planowanych zakupów do Korei Południowej (znakomicie wywiązuje się z dotychczasowych kontraktów) lub Francji (najsilniejsza armia w UE). Także rozwój energetyki jądrowej nad Wisłą byłoby wtedy lepiej rozwijać z Francuzami, którzy staliby się fundamentem obrony UE – mając broń atomową i dobrze rozwinięty przemysł zbrojeniowy.
Dominująca rola USA w świecie Zachodu daje im również wiele innych korzyści. Chociażby możliwość wpływania na rządy państw sojuszniczych, by nie dokonywały zmian niekorzystnych dla spółek znad Potomaku. O wycofaniu się Polski z wprowadzenia podatku cyfrowego „poinformował” polską opinię publiczną… wiceprezydent Mike Pence. Amerykanie wymusili również zablokowanie ustawy Lex TVN. Podobne działania podejmują w wielu innych państwach sojuszniczych, które grzecznie zginają kark, licząc na parasol ochronny rozciągnięty nad nimi przez Waszyngton. Jeśli ten parasol zostanie zwinięty, to uległość wobec amerykańskich firm także zniknie.
Warto też przypomnieć, że dotychczas tylko raz skorzystano z artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego, który zobowiązuje państwa sojusznicze do pomocy zaatakowanemu państwu członkowskiemu. Tym państwem były USA po atakach na World Trade Center i Pentagon w 2001 roku. Państwa sojusznicze z UE wysłały po kilka tysięcy żołnierzy do Afganistanu na misję, która trwała łącznie dwie dekady. Część sojuszników USA wsparła Waszyngton także podczas wojny w Iraku, która jak się potem okazało, była oparta w części na fałszywych przesłankach.
Tak więc na razie w praktyce to USA wyłącznie skorzystały ze wsparcia sojuszników w ramach NATO. Oczywiście można zauważyć, że wiele innych krajów nie skorzystało z artykułu 5, gdyż USA wystarczająco odstraszają potencjalnych agresorów. I prawdopodobnie jest to prawdą, jednak w zamian Waszyngton ma uprzywilejowaną pozycję na całym Zachodzie, dosyć arbitralnie kształtując porządek globalny według swoich aktualnych potrzeb.
Gdy dla USA korzystne było liberalizowanie handlu, forsowały one w ramach negocjacji GATT, a potem w WTO, znoszenie barier celnych. Gdy doprowadziło to do ucieczki części przemysłu, obrażeni Amerykanie sami zaczęli łamać ustanowione przez siebie zasady, nakładając cła i grożąc wszystkim dookoła kolejnymi.
Administracja Trumpa zdaje się nie zauważać, że obecna pozycja USA jest oparta na zaufaniu – do dolara, do przewidywalności rządu w Waszyngtonie i do niezawodności amerykańskiej armii. Jeśli Trump i jego współpracownicy faktycznie zaczną łamać podpisane umowy oraz własne reguły gry, to zaufanie do nich legnie w gruzach. Podobnie jak pozycja dolara, atrakcyjność amerykańskiej broni oraz uprzywilejowana pozycja USA w krajach Zachodu.

 Wspieraj
Wspieraj 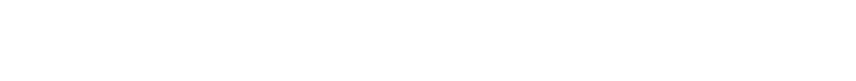

 Wspieraj
Wspieraj  Wydawnictwo
Wydawnictwo 
 Zaloguj się
Zaloguj się